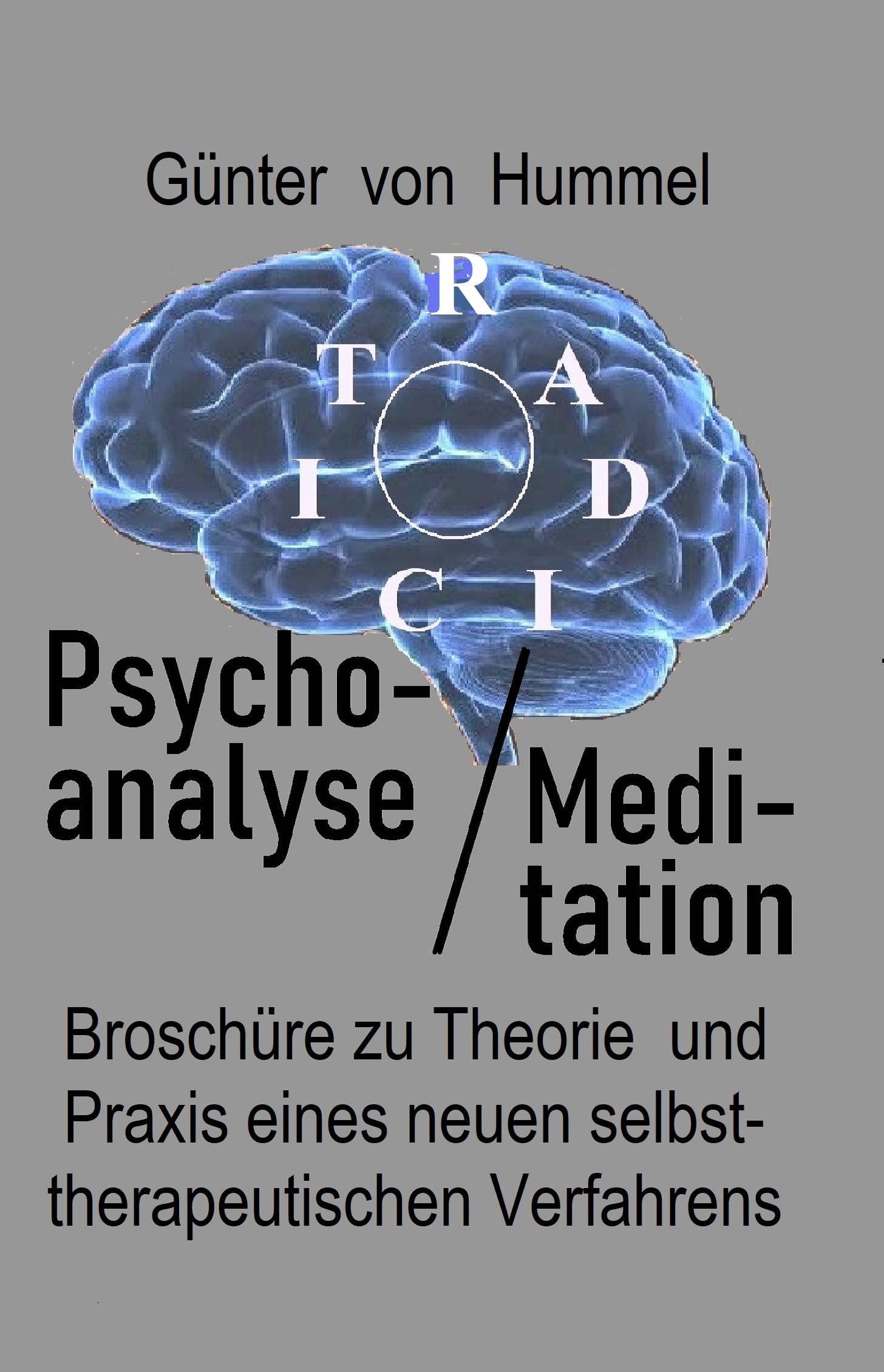In seinen Seminaren verkündete J. Lacan oft den Satz: „Lieben heißt geben, was man nicht hat". Denn selbst wenn man liebt, wie kann man es dem anderen hinüberbringen, wie kann man erreichen, ja sicher sein, dass er die gleiche Liebeserfahrung hat wie man selbst? Ja auch in dem Falle, dass es etwas gibt, das von einem zum anderen als gesicherte Liebeserfahrung, als Liebesbeweis gilt, so beweist dies doch nur ein funktionierendes logisches System zwischen beiden, aber beweist es wirklich die Liebe als solche, die Liebe absolut? Was der Psychoanalytiker also meint, wenn er sagt, „Lieben heißt geben, was man nicht hat", ist doch, dass man in der Liebe auf einem Niveau gibt (ontologisch gibt), also auf dem Niveau eines Seins, wo der andere ein Haben liebt, so dass man selbst fast gar nicht mehr geben muss, was als echtes Liebes-Sein zu haben wäre. Mag sein, dass das alltägliche Verliebtsein, die Gefühlsliebe, das romantische Lieben ein derartiges Lieben beinhaltet. Das schwärmerische Lieben schließlich, das man dem anderen schenkt, ist tatsächlich etwas, was mit einem Sein ohne Haben oder einem Haben ohne Sein gut bezeichnet ist.
Denn geben wir wirklich - wie beispielsweise der heilige Georg - die Hälfte unseres Mantels, wenn es um Liebe zum Nächsten gehen soll? Unseres Nerzmantels z.B.? Wir geben Decken, Zelte und Milchpulver, wenn es in der dritten Welt zu Katastrophen kommt. Doch die Mädchen im Bosnienkrieg träumten nicht nur von einer warmen Decke, sondern sie rissen sich um das Bild aus einer Zeitschrift von Cartier, denn sie hätten auf manche Decke und Zeltplane gerne verzichtet für ein Kleid von Armani oder Dior! Wer Hungerhalluzinationen hat, sieht nicht ein trockenes altes Stück Brot vor sich, das seinen Hunger stillen würde, sondern lukullische Speisen, Tische, die sich von Köstlichkeiten biegen. Warum bringen wir den Armen nicht die Hälfte unserer Sport- und Geländewagen, die Hälfte unserer Elektronikspielsachen oder Designer-Möbel? Das wäre doch wahre Liebe! Was Lacan meint, betrifft also die alltägliche Liebe, das Verliebtsein, die Emotion.
Doch Lacan paraphrasiert noch weiter und verkündet, dass „Geben, was man hat, hieße ein Fest machen". Unsere Pelzmäntel und Kleider von Massimo Dutti würden also auch noch nicht voll das erfüllen, was es mit der Liebe wirklich auf sich haben könnte. Es muss noch etwas anderes geben. Nun ist es immer heikel und schwierig, oft ungeschickt und missverständlich, wenn man dann auf einen Minnegesang oder spirituellen Höhenflug anhebt und eine Liebe beschwört, die über alles hinausgeht und die die höchsten Lorbeern verdienen würde. Ich habe daher an anderer Stelle schon auf die Liebe hingewiesen, die es im frühen Judentum gab und die man Ahava nannte. Sie war sowohl sinnliche wie auch übersinnliche Liebe, wohl dem sokratischen Eros verwandt, der ja auch ein Gott war und doch auch von den Menschen gelebt wurde. Mir scheint, dass diese Liebe heutzutage fast ausgestorben ist, weil wir viel zu rational überfrachtet sind und uns nur entweder eine irdische oder einen himmlische Liebe vorstellen können. Denn bei Ahava galt eher die Formel: „Lieben heißt geben, was man ist". Und wer kann dies schon in unserer heutigen modernen Welt?
Es klingt freilich auch irgendwie pauschal und etwas fundamentalistisch. Wie kann man geben, was man ist und dies dann als Liebe bezeichnen? Im Krieg haben die Menschen ihr Leben gegeben, also sich, ganz und gar, und war dies Liebe? Liebe zur Nation, hat man gesagt, oder Liebe zur Religion. Nur trotzdem: man hat seinen Körper gegeben, eine im Körper wohnende idealisierte Emotion, aber ist man nicht eigentlich mehr als das? Was ist mit den Einsichten, Erkenntnissen, wichtigen Gefühlen und Gedanken, den verinnerlichten Seelen anderer Menschen, den Wünschen und den Wahrheiten, die man sich erarbeitet hat und vieles andere mehr? Es geht doch nicht nur um das Ich, es muss doch ums ganze Subjekt gehen, um ein Universum an innerlichen „Objekten" - so wie es die Psychoanalytiker verstehen. Sie sagen, dass der mensch ein Beziehungswesen ist von „Sub-Objekten" zu „Sub-Objekten" (also von Subjekten, die man in objektbezogener Weise ausdrücken können muss). Könnte man sich so verschenken, dass alles mitkommt, was man ist und an Persönlichkeit und Reife, an Universalität und Ganzheit alles gegeben wird und noch dazu mit Liebe?
Ja, um so etwas geht es bei Ahava und bei dem, was ich hier vorhabe. In der Psychoanalyse konstituiert sich der Analytiker als Objekt der Übertragung (Bedeutungen aus anderen oder früheren Beziehungen werden auf den Therapeuten übertragen) seines Patienten. Er kann das Liebes-oder Hassobjekt sein, etwas Idealisiertes oder Negativiertes. Somit muss er sich selbst geben als „Spielball der [liebenden] Götter" wie es der Schriftsteller Hagelstange einmal ausdrückte oder als Kriegsschauplatz der begehrenden Menschen. Auf jeden Fall sind Liebe und Begehren hier nicht getrennt, und das ermöglicht ein Geben von dem, was man ist. Geben, was man ist heißt damit nicht, seine eigene Persönlichkeit und Reife aufgeben, drangeben, gar an den anderen verlieren. Die Betonung liegt vielmehr auf dem „was" man ist, nicht „wer" man ist. Dieses „was", das der Psychoanalytiker N. Symington auch die „Thathood", die „Dasheit" nannte, habe ich versucht in eine noch kompaktere Form, in ein noch unmittelbareres Beziehungssymbol zu packen, um das Geben so noch einfacher und direkter zu gestalten. Denn es handelt sich um ein dem menschlichen und Freudschen Unbewussten angepasstes „Ding" (ein Ausdruck Lacans, der an das „Ding an sich" von Kant erinnert). Um einen „linguistischen Kristall" (auch ein Ausdruck Lacans, um ein topologisches Liebesobjekt.
Ich verweise hierzu wieder auf andere Artikel auf meiner Webseite oder die Broschüre „Die körperlich kranke Seele", in der die Praxis dieses Gebens, dieser Gabe auch von ihrer praktischen Seite her dargestellt ist.