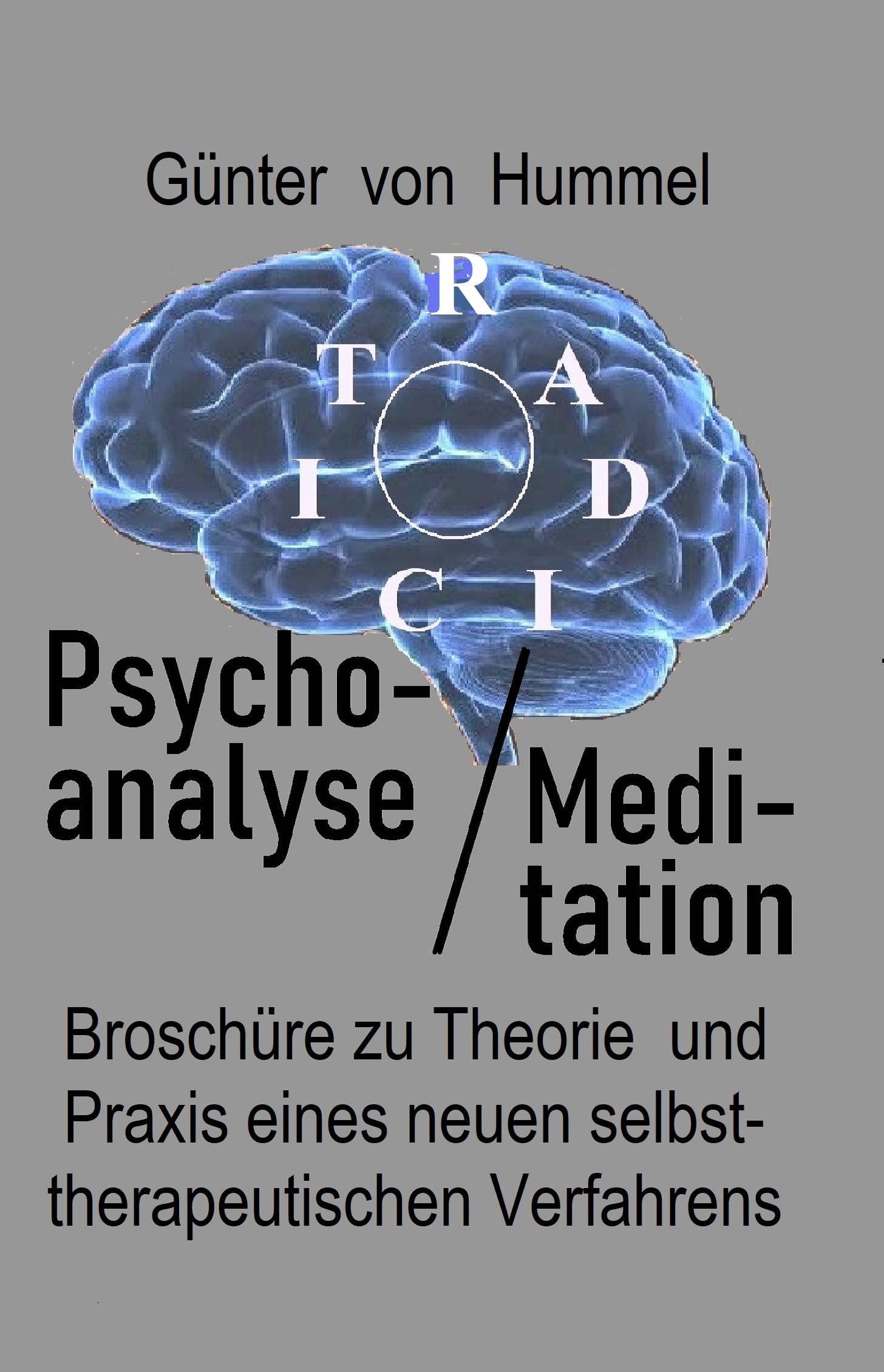Über das „Getast“ und das „Sprachlich-Sichselbst-Vorausgesetzte“.
„Das Kollektiv ist das Subjekt des Individuums“, schreibt Lacan. Was soll das heißen? Das Individuum mit seinem Ich steht nicht im Zentrum des Umfassenden, das seine Persönlichkeit ausmachen könnte. Entweder ist es durch Impulse, Strebungen aus den unbewusst gebliebenen Antrieben mit gesteuert oder lässt sich von Idealisierungen verführen oder von den Rationalisierungen des Überichs im Griff halten. Es kommt nicht zu sich selbst als Subjekt, als ein Etwas, das sich klar und bewusst all diesen Einflüssen unterstellt sieht, weil es auf das Kollektiv bezogen ist, mit dem es lebt.
Der Begriff des Kollektivs hat natürlich seine Tücken. Früher hat man vom Clan, von der Sippe, vom Volk, ja von der Nation oder gar von der Menschheit gesprochen als dem Kollektiv, dem man sich zugeordnet fühlt. Doch der Clan ist zu klein, die Nation politisch zu aufgeladen, zu riskant überhöht und die Menschheit zu groß, zu uferlos groß. Wie soll man die Gruppe der Menschen definieren, die über den Clan, die Familie und Sippe hinaus all die Freunde und anderen Menschen umfasst, die man noch einigermaßen überblickt oder der man sich zugehörig und für die man verantwortlich – wenn auch nicht immer fühlen – so doch denken kann? Es gibt keine feste Definition dafür. Es ist eine Art Schicksalsgemeinschaft, zu der ja auch frühere Menschen und Nachkommen zählen und auch noch ein paar aus weiter Ferne so wie der Freund aus China oder ein fremdsprachiger Schriftsteller oder gar so jemand wie Hamlet zum Beispiel. Denn Hamlet ist ja nicht völlig tot. Wir begegnen ihm in manchen Menschen immer wieder oder auch in uns selbst.
Zum Kollektiv gehören jedenfalls außer all den Menschen mit denen man zu tun hat auch jene, die in einem innerlich immer wieder auftauchen, sei es dass man den Klang ihrer Stimme erinnert und sich dann frägt, zu wem genau diese Stimme gehört. Oder sei es dass man sie im Traum oder Wachtraum sieht, fühlt, spürt oder gar eins ist. Mit jemanden Eins-Sein ist immer gefährlich, obwohl es letztlich immer darauf ankommt und vor allem darauf ankommen wird, mit wem man wirklich Eins-Sein kann. Die Burmesen beispielsweise sind hauptsächlich Buddhisten und sehen in Buddha bzw. in seiner Natur etwas Göttliches, das durch seine Schriften und Lehren gestützt wird. Dennoch glauben die meisten Burmesen noch an die Nats, persönliche Geister, die durch menschliche Medien vermittelt und die ihnen dadurch viel näher stehen als eine entrückte spirituelle Figur. Richtig Eins-Sein können sie aber mit niemand, denn sie bleiben in diesen verschiedenen Orientierungen gespalten. Es müsst etwas geben, das zwischen diesen zu entrückten und zu nahen Wesen steht. Vater und Mutter sind es nicht mehr, das ist klar, Hamlet kann es auch nicht sein, selbst wenn er immer wieder auftaucht. Den Ehepartner klammere ich jetzt erstmal aus, denn darüber müsste man eine lange Abhandlung schreiben. Ein guter Freund, ein Neurologe, der Christengott (evangelisch, adventistisch, unitarisch, katholisch etc.) und tausend andere sind es auch nicht.
Es muss ein Jemand und auch ein Etwas in einem selbst sein, ein Außen-Innen und Innen-Außen. Auf jeden Fall ist es außen etwas, das man als Jemand wahrnehmen kann und innen etwas, das der Philosoph G. Agam¬ben das „Sprachlich-Sichselbst-Vorausgesetzte“, das Worthaft-Vorverfasste darstellt. „Die Sprache ist das, was sich notwendig selbst voraussetzen muss“, schreibt er. Sie ist der „autologischen Struktur der Voraussetzung selbst eingeschrieben“, was philosophisch gut gesagt, aber allgemein nicht klar genug ausgedrückt ist. Es handelt sich um etwas Ähnliches, was ein anderer Philosoph, D. Roazen, den „inneren Sinn“ nennt. Zumindest versucht Roazen das, was Agamben mehr linguistisch einkreist bildhaft zu formulieren. Roazen führt den „inneren Sinn“ auf die alten griechischen Philosophen zurück. Zuerst auf Sokrates, der meinte, dass die Wahrnehmung, die aisthesis, nicht nur Gesichts-, Gehörs und Geruchssinn bedeutet, sondern auch Lust, Unlust, Begierde etc., also innere Wahrnehmungen. Aristoteles sprach dann von der koinä aisthesis, dem „Gemeinsinn“, der nicht nur allen gemein war, sondern auch einem selbst als einem grundlegenden „Wahrnehmungsvermögen“. Doch die Sache geht noch weiter. Die Psychoanalyse schon vorausahnend erklärten die alten Griechen, dass dieses Wahrnehmungsvermögen etwas mit dem Gespür, ja dem „Getast“, dem Tastvermögen zu tun haben muss, das nicht nur mit der Hand nach außen tastet, sondern mit einer Art eingestülpter Haut auch nach innen. Haphe kai koinä aisthesis tauton estin, tastende Berührung und der Gemeinsinn sind dasselbe.
„Das Mensch“
Freud sprach diesbezüglich davon, dass es das Unbewusste selber ist, das „mittels des Systems W-Bw [Wahrnehmung - Bewusst¬sein] der Außenwelt Fühler entgegenstreckt“, was auf dieses primäre Tasten, Erfühlen hinausläuft. Es ist so als könnte die Seele sich von innen aus- und vorstülpen und so eine direkte Erfahrung der Welt haben, indem es also ein „Es Fühlt“, „Es Tastet“ gibt, in dem wir ständig baden. Und tatsächlich, wir sprechen problemlos von der Schaulust, aber nicht so einfach von der Tast- und Berührungslust. Wir sprechen vom Blick als dem Objekt der Schaulust, aber nicht vom Getast als dem Objekt der Berührungslust. Dies liegt wohl daran, dass das Getast viel intimer und erotischer erscheint als Blick (Gesichtssinn) und Stimme (Gehör). Das Getast steht der primären Identifikation näher als Sehen und Sprechen. Würden wir jemanden sofort mit unserem Getast einhüllen, umfassen ertasten können, hätten wir viel mehr die Erfahrung eines „Verschmel-zungserlebnisses“ als durch die übliche Wahrnehmung, die statt zu einer Identifikation eher zu einer „Objektbesetzung“, „-beziehung“ führt wie man in der Psychoanalyse sagt.
Das Getast ist also wohl etwas, das „urverdrängt“ ist, so verdrängt also, dass wir es nicht so einfach und direkt nutzen können. Und damit kann ich jetzt wieder zum sprachlich Sichselbst-Voraussetzenden zurückkommen. Denn dies ist ja auch so etwas Ur-Verdrängtes, etwas, das wie ein „Gerüchtssinn“, ein „Es Verlautet“ in einem noch ganz ursprünglichen Sinn, von dem man nichts weiß, ist er innen oder außen. Was einen berührt (ertastet, erfühlt) ist ähnlich dem, was einen angeht, anspricht. Was einen berührt und angeht, ist innen und außen zugleich. Und genau dies macht das Kollektiv aus. Der Psychoanalytiker N. Symington nannte es die Thathood, die „Dasheit“, die ein Kollektiv verbindet und zusammenhält. In einem gewissen „Das“, in einem „das Mensch“ – wenn man es einmal so sagen darf - sind sich alle einig. „Das“ sollte eigentlich alle Menschen umfassen, aber soweit geht es meistens wohl nicht. Ich weise jetzt nur noch kurz darauf hin, dass man „Das“ mit der Analytischen Psychokatharsis erfahren und erlernen kann.