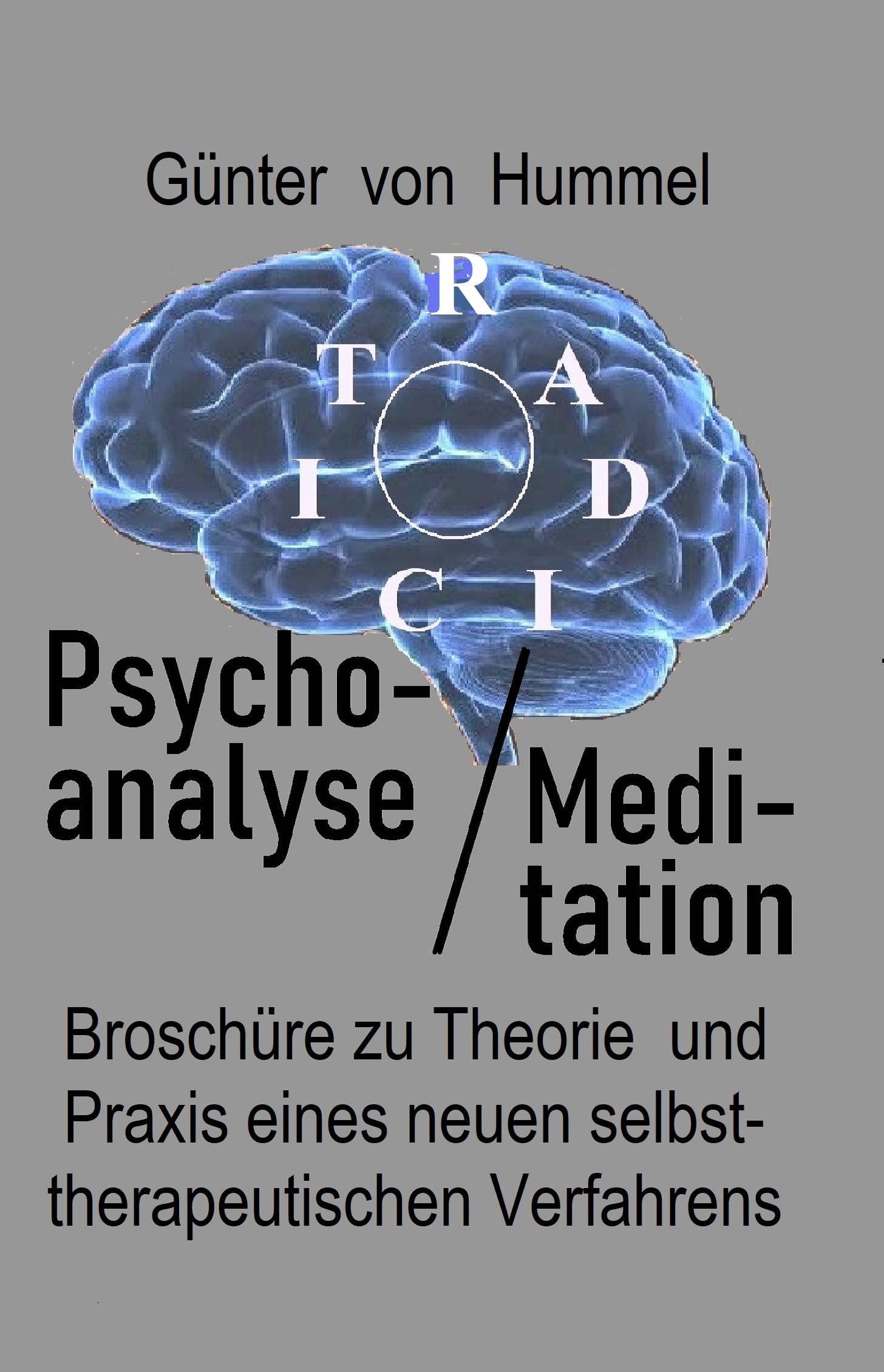In einem Artikel der PSYCHE Nr. 1, 2014, schreibt der Psychoanalytiker und Theologe H. Will über S. Freuds Atheismus und dessen Bezug zur Religion. Will meint, dass Freud in einer „Doppelexistenz von jüdischer Identität in der Lebenspraxis und deutsch-europäischer Identität in Wissenschaft und Kultur“ gelebt habe. Dies sei aus der damaligen Zeit heraus nachvollziehbar, aber heute könnte man das Religiöse nicht mehr so aus der Psychoanalyse heraushalten. Es klingt danach, dass der Psychoanalytiker doch auch etwas Gottglauben bewahren und dies mit seiner Wissenschaft vereinbaren sollte. Freud sei also in sich gespalten gewesen und kein Analytiker sollte heutzutage einfach sagen, dass er Atheist sei.
Ich denke jedoch, dass Will zu wenig Religio als wörtlich Rückbindung ans Ursprüngliche, innerlich Schöpferische von Confessio als reiner mehr äußerlicher Bekenntnis unterscheidet. Diese Unterscheidung korreliert auch mit den zwei Aspekten des Unbewussten, dem mehr beharrenden und dem mehr schöpferischen (S. Leikert, Sonderheft PSYCHE Sep./Okt. 2013, S. 962). Zu dem Schöpferischen der Religio haben nur wenige Menschen etwas beigetragen wie etwa die Religionsstifter selber oder einige der großen Erneuerer. Die meisten Menschen sind einfach einer Konfession, einem Katechismus, gefolgt und tun dies noch heute. Ein altes Sprichwort heißt: Gott schuf den Menschen und der Mensch die Religionen (also in meiner Ausdrucksweise die Konfessionen). Diese letztere Religionsausübung kritisiert Freud als zwangsneurotisch, aber die Religio als schöpferischen Prozess, früher als großes Mythenschaffendes, heute als psychologisch um die Vater-Metapher-Kreisendes hat Freud interessiert und hätte ihn heute sehr beschäftigt. In einem Brief an Binswanger schreibt Freud, dass, „hätte ich noch ein Arbeitsleben vor mir, so getraute ich mich auch jenen Hochgeborenen [Religion und Kunst] eine Wohnstatt in meinem niedrigen Häuschen anzuweisen“ ( Binswanger, L., Ausgew. Werke, Bd. 3 (1994) S. 26). Damit meint er nicht, dass er sich jetzt mehr zum Judentum bekennen müsste, weil dies so tief in ihm verankert ist.
Sein Kontakt zu Juden und zur jüdischen Gewohnheiten ist bei ihm daher ganz zurecht nur Beiwerk seines gesellschaftlichen Lebens. Ich glaube nicht, dass er diesbezüglich gespalten war und innerlich tief im jüdischen Glauben wurzelte. Er hat nur nicht die Zeit gehabt so ein gutes Buch wie die amerikanische Analytikerin D. Zeligs zu schreiben, in dem diese eben über den kreativen Prozess des Moses´schen Werkes aus psychoanalytischer Sicht schreibt (Zeligs, D. F., Moses, A Psychodynamic Study, Human Sciences Press (1986). Hochinteressant wie Zeligs die Familienbeziehungen (seiner zwei Mütter, Jokebed und Bithya, seiner Geschwister Aaron und Miriam etc.) und viele der Begebenheiten aus Moses Leben deutet. Das wollte Freud erforschen, in dieser Hinsicht ist er „religiös“, all die üblichen Formen des mehr äußerlich Religiösen dagegen interessieren ihn nicht bzw. lehnt er als neurotisch ab. Das hindert ihn natürlich nicht Beziehungen zu den vielen im damaligen Wien lebenden Juden zu haben und auch ange-sichts des aufkommenden Antisemitismus gelegentliche positive Bekundungen zu jüdischen Kreisen zu äußern so wie wir dies heute ja auch tun. Kurz gesagt galt für ihn ein „Gott ja, Kirche nein“, wobei er den „Namen des Vaters“, die Vater-Metapher als solche – wie Lacan dies nennt – nicht als Gott titulieren musste.
Diese Argumente hatte ich dem oben genannten Autor H. Will brieflich mitgeteilt, worauf er mir zurückschrieb: „Sicher ist meine Perspektive auf Freud auch persönlich geprägt, wie es mir überhaupt auffällt, wie ausgesprochen unterschiedlich wir alle an die Thematik der Religion herangehen. Jeder hat seine Erfahrungen und Überzeugungen im Hintergrund. Wahrscheinlich war Freuds Identifizierung mit dem Judentum (nicht mit der ausgeübten Konfession) doch sehr tiefgreifend, zumal er ja ganz in Ihrem Sinne die Konzentration auf den Vatergott und dessen Überwindung als einen Gewinn des jüdischen Denkens ansah. Das Ganze gipfelte in seiner Sicht dann in der Psychoanalyse. Große Geister dürfen ruhig auch etwas grandios denken“.
Trotz Wills verbindlicher Antwort meine ich, dass es eben umgekehrt ist: die Konzentration auf den Vatergott ist sicher das große jüdische Erbe, aber dessen Überwindung hat ja gerade das jüdische Denken nicht geleistet, sondern Freuds Psychoanalyse. Bei den Jüdischen Orthodoxen findet man doch so extrem die Ritual- und Operationalisierungen hinsichtlich dieses monotheistischen Vaters, so dass man zu Recht von diesen Gläubigen sagen kann, das für sie Gott „das Ichideal das Zwangsneurotikers“ ist, wie Freud es ausdrückte. Freuds Identifizierung mit dem Judentum mag zu einem kleinen unbewussten Rest noch vorhanden gewesen sein. Aber seine eigentliche Identität war die des Psychoanalytikers, der seinen Patienten nichts vorschreiben und suggerieren will. Kein gebot, keinen Gott, keinen Vater. Der Patient muss alles selbst herausfinden und in eigene Worte kleiden. Die wirkliche Überwindung dieses Vatergottes findet sich am eindrucksvollsten bei Freuds Nachfolger Lacan.
Denn Lacans Konzept stellt einen Ausweg aus dem Konflikt zwischen Religion und Psychoanalyse dar. Die Vater-Metapher, „Les noms du père“ (die Namen des Vaters) klingen im Französischen gleich wie „Les non Dupes errent“ (die Nicht-Blöden irren) und wie „Les non du père“ (die Nein des Vaters). Lacan wollte aus dieser Überdeterminierung, die trotz mehrerer Bedeutungen weniger sagt, weil man nicht mehr weiß, was wirklich gemeint ist, eine grundlegende Vater-Metapher für die Psychoanalyse machen. Man sollte nicht sagen können, wer Gott ist oder was es heißt ein Vater zu sein. Diesen grundlegenden Namen, diese Vater- oder Gott-Metapher sollte nur das Subjekt selbst sagen können, jeder einzelne also, der sich seines Subjektseins bewusst ist. Aus der Mehrdeutigkeit des „Les non Dupes errent, . .non du père und . . noms du père“ sollte man gerade keinen bestimmten Gott-Namen herauslesen können, sondern auf die Grund-Metapher in sich selbst gestoßen werden. Vielleicht war Freuds Be-zeichnung für Gott als dem „Ich-Ideal des Zwangsneurotikers“ zu krass formuliert. Lacan nannte Gott „einen Körper ohne Gestalt“, also etwas Signifikantes, das aber nicht fassbar, nicht vorstellbar und nicht benennbar ist. Ein solcher „Körper ohne Gestalt“ war auch nicht allmächtig und schon gar nicht allwissend.
Am ehesten könnte man dem katholischen Religionsphilosophen R. Spaemann folgen, der meinte, Gott sein „ein unsterbliches Gerücht“. Es wurde immer von ihm geredet und es wird immer von ihm geredet werden und in dieser Form hat Gott eine echte Existenz. Das ist natürlich nicht das, was die etablierten Religionen unterschreiben würden, weil sie eben Konfessionen sind, die an althergebrachten Papierstücken und ausdruckbaren Vorschriften hängen. Freud hatte schon Recht, wir brauchen eine Religion ohne die vier Buchstaben G, o und zweimal t. Er hätte nicht sagen sollen, dass er Atheist ist. Er hätte sagen sollen, dass jeder die wahre Religio in sich selbst finden muss, und dies heute nur im weitgefassten Rahmen der modernen Wissenschaften möglich ist. Z. B. im Sinne einer Konjekturalwis-senschaft, wie sie schon Nikolaus von Kues zu begründen suchte.
In der Konjektural- oder Vermutungswissenschaft geht man wie in der Mathematik vor. Man schreitet von plausibler Vermutung zur weiter plausibleren Vermutungen, die man durch immer mehr Fakten und Beweise anzureichern und zu stärken versucht, bis man die letztmögliche Wahrheit erreicht hat. Jede Wahrheit darüber hinaus wäre so etwas wie Gott selbst, und das kann niemand selbst sein. Aber es wäre wahre Religio und wir benötigten keine konfessionellen Religionen mehr. Auch eine psychoanalytische Selbsterfahrung könnten wir so gewinnen. Dazu habe ich auf der Basis der genannten Lacan´schen Vater-Metapher ein Verfahren entwickelt, das dabei hilfreich sein kann (www.analytic-psychocatharsis.com).