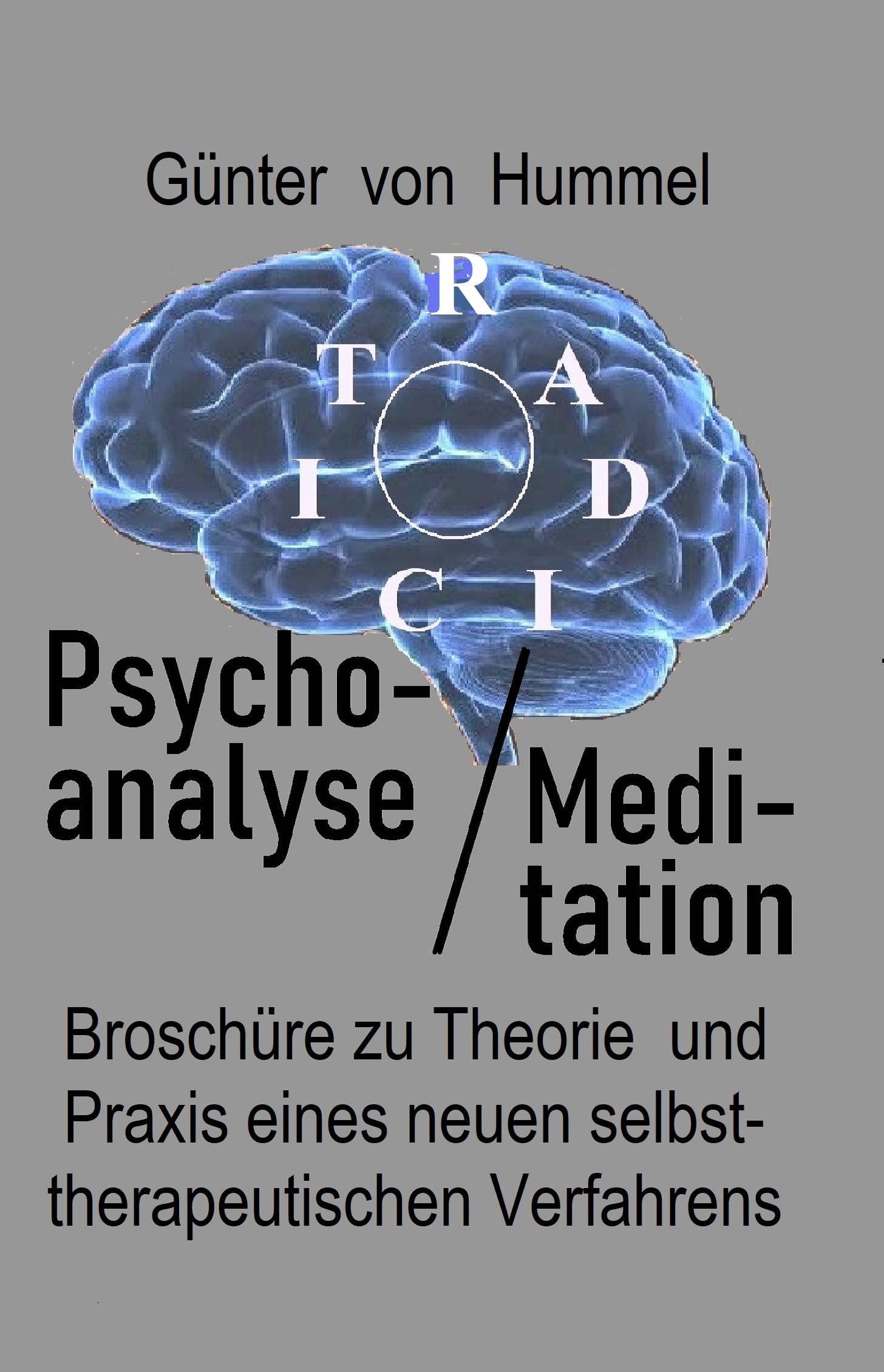Was früher dem Menschen die Macht und der Krieg war, wurde später zum Phänomen von Kapital und Ausbeutung. Um diese Strukturen besser zu erklären, verwandte Freud die Begriffe des Sexuellen und Aggressiven in ihrer unbewussten Form. Beim Machtmenschen wie beim Kapitalisten stand also das Aggressive, fast müsste man sagen die Aggressivität, im Vordergrund, moti-vierte sich aber auch aus den Kräften der Lust. Das Unbewusste Freuds bestand somit aus einer Mischung dieser beiden Grundtrie-be, die sich gegenseitig zwangen, immer wieder neu in den Zyklus ihrer Gestaltung einzutreten. Freud sprach daher von Wiederho-lungszwang oder vom Todestrieb, da sich diese Gestaltungen bis zum geht nicht mehr wiederholen mussten. Dies ist auf der Seite einer Betonung des Sexuellen gegenüber dem Aggressiven nicht anders. Schon im Ödipuskomplex wird es deutlich, wenn das Ag-gressive sich gegen das Gleichgeschlechtliche richtet und das Ero-tische sich zum Gegengeschlechtlichen der Elterngeneration wendet.
In seiner Schrift über „Ein Kind wird geschlagen“ verdeutlicht Freud diese Verhältnisse der sogenannten ‚Ödipalität’ in Form ge-nau des gerade formulierten Sexuell-Aggressiven, des Sadomaso-chistischen und anderer Formen der Sexualität, der damit im Zu-sammenhang stehenden Phantasien und Träume. Kultur, Arbeit, sozialer Umgang und vieles mehr kann diese Wiederholungsstruk-turen sublimieren, also verfeinern, lockern, entlasten, aber nicht endgültig lösen. Dazu bedarf es eines besonderen Verfahrens wie es eben die Freud’sche Psychoanalyse darstellt. Doch gerade was den Wiederholungszwang angeht, was die tieferen Grundkomplexe betrifft, reicht auch oft die Psychoanalyse nicht aus, auch wenn sie wissenschaftlich sehr gut ausgearbeitet ist und langwierig und aufwendig betrieben wird. Dafür sind direktere und ebenso wissenschaftlich entwickelte Verfahren geeigneter.
Zwei Aspekte eines derartigen Verfahrens will ich herausheben. Das eine ist die ‚Augenscheinlichkeit’, die ich ausführlich in mei-nem Buch ‚Wir sind Film’ beschrieben habe. Vereinfacht ausge-drückt handelt es sich um eine Art des primären Sehens, des ur-sprünglichen Schauens, bildhaften Erfassens. Freud sprach hier von der Wahrnehmungsidentität, also von der Fähigkeit das bildhaft Erfasste mit einer Identitätslust zu verbinden. Die Dinge werden dadurch besonders stark, intensiv und selbstüberzeugend wahrgenommen, während wir sie später im Leben durch unsere kulturellen Vorgaben, psycho-physischen Angewohntheiten und Fixierungen sehen. In er ‚Augenscheinlichkeit’ erfahren wir, dass das, was das ‚Schauen’ das Sein ist. Was nicht inmitten der Schau ist, existiert nicht, denn was sollten die Dinge sein, wenn sie nicht erfasst werden. Sie sind dann zwar in ihren reinen Gegebenheit vorhanden, aber das letztliche Gesetz, nach dem sie vorhanden sind, ist selbst nicht vorhanden. Ein Naturwissenschaftler wird sa-gen, die Dinge existieren dann eben in ihren physikalisch-chemisch-biologischen Zusammenhängen, aber wer kann hier von Zusammenhängen sprechen, wenn er selber, als Sprechender, damit gar nicht zusammenhängt? Gewiss werden in der ‚Augen-scheinlichkeit’ diese letztlichen Gesetze auch nicht präzise genug ‚geschaut’.
Nun versucht man exakt in dem Sinne des oben erwähnten Subli-mierens die ‚Augenscheinlichkeit’ wieder zu gewinnen und zu verstärken, indem man Gesten, Rituale aber auch Literatur und bildende Kunst dazu einsetzt, Ursprünglichkeit und Authentizität herzustellen. Schon bei einer so einfachen Geste wie dem Ein-schenken duftenden heißen Tees in eine dafür eigens zu verwen-dende Tasse ist so etwas nachvollziehbar. Das Geräusch, mit dem der dampfende Tee langsam in die Tasse perlt oder , sprudelnt fließt und dabei bereits die Ahnung seines vollen Aromas und sei-nes Geschmacks ankündigt, kann solche Gefühle von uralten Na-turgeschehnissen wiedererwecken. Man muss nicht M. Proust ge-lesen haben und die Rituale seiner Wiedererinnerungen an die frü-heste Kindheit, um diese ‚Gefühlsscheinlichkeit’ – es muss nicht nur das Visuelle angesprochen sein, es kann auch die Tast- und Geruchsempfindung am Anfang stehen – nachvollziehen zu kön-nen. In Marokko wird aus diesem Grund der nach stark riechende Minztee so eingegossen, dass die Teekanne relativ rasch hochge-zogen wird und der sprudelnde Einfluss somit noch effektvoller demonstriert ist.
Trotzdem kann diese ‚Gefühls’- oder ‚Augenscheinlichkeit’ durch Sublimation mittels all dieser kulturellen Anstrengungen allein nicht ausreichend erreicht werden. Sie müssen noch mit etwas kombiniert werden, das sie nicht nur vermehrt, sondern auch auf andere Weise sublimiert. Ich habe diese zweite Form der Ur-sprünglichkeit, die gleichzeitig ein Ansatz zur Sublimierung ist, in dem oben zitierten Buch als das ‚Gedankenhören’ tituliert. Freilich ist auch dieser Begriff nicht unproblematisch. Viele Autoren (Phi-losophen, Wissenschaftler und auch etliche Psychoanalytiker) „wissen nicht“ – so Lacan – „dass diese Triebe“ – und besonders derjenige, den ich hier mit dem Begriff des ‚Gedankenhörens’ an-spreche – „ein Echo des Körpers sind.“
Dazu muss der Körper, wie Lacan weiter betont, lediglich sensibel für Resonanzen und Konsonanzen sein. Im Vordergrund steht hier eben das Sprech-Hörsystem, das immer offen ist (es kann nicht wie das Auge geschlossen werden) und somit hallt es von all den Lauten wieder, die nicht verarbeitet werden konnten (Lacan spielt hier auch mit dem Wort se boucher, verstopft werden, was nach bouche, dem Mund klingt, der hier also auch als verschlossen un-terstellt wird). Eben dadurch raisonniert es im Hör-Sprechsystem, was nicht nur an die physiklische Resonanz, sondern auch ans Rai-sonnieren, ans Nachdenken, erinnert. Und damit ist man wieder beim ‚Gedankenhören’. Denn wenn es eine Möglichkeit gibt, nicht nur nachzudenken, sondern auch mental, psychisch, ins Sprech-Hör-System direkt einzudringen, dann können deren Inhalte auch direkt wahrgenommen werden als ein unmittelbareres Raisonnie-ren, so wie Freud das Unbewusste aufgefasst hat, als er von unbe-wussten Gedanken sprach.
Doch das ‚Echo des Körpers’ ist nicht nur ein Echo von einfachen Lauten. Die Laute sind semantisch aufgeladen, sie sind Laute von Subjekten und nicht von Objekten. Hinter diesen Lauten steckt nicht ein Etwas, sondern ein – wenn auch unbestimmter, unbe-wusster – Jemand. Aber was heißt das? Der Philosoph. Hegel stell-te in seiner Dialektik von Herr und Knecht die Sache so dar: der Herr verzichtet auf den unmittelbaren Lebensgenuss, er nimmt den Tod in Kauf. Dafür zählen seine Laute umso mehr, denn sie sind ja schließlich das einzige, was von ihm wahrzunehmen ist. Da er – vordergründig zumindest – nichts beansprucht, wirkt er selbst wie ein Spruch, sind seine Äußerungen Macht-, Herren-Worte. Der Knecht dagegen genießt unmittelbar du steht daher in ständigem Kampf mit dem Herrn, auf dessen Tod er sozusagen wartet oder warten muss, um endgültig zum Zug zu kommen.
Der Herr glaubt zum Zug zu kommen, wenn er aus seinen Herren-Worten – Lacan spricht hier vom Herren-Signifikanten – eine Ide-ologie gezimmert hat. Doch beiden, Herr und Knecht gelingt der letztliche Sieg, die letztliche Etablierung ihrer Strebungen nicht. Sie reiben sich bis ins Unendliche hin auf. Freud stellte daher nicht die Herr / Knecht-Dialektik in den Vordergrund. Er betonte die Dialektik von Mann und Frau, vom Herrn und seiner Geliebten. Auch hier verzichtet der Herr darauf, ständig nur Mann zu sein, ständig nur sexuellen männlichen Genuss zu haben. Dafür muss die Frau seiner Familiendynastie zustimmen. Sie muss auf seine Impotenz warten um die Verhältnisse umdrehen zu können und sich als omnipotent zu etablieren. Denn eine gewisse Form der Omnipotenz ist ihr sozusagen angeboren. Ihre Libido schließt sich in ihr zum Kreis, sie muss dazu nicht immer einen männlichen Partner haben. Doch beiden, dem Herrn und der Geliebten, gelingt es nicht eine endgültige Synthese der Liebe zu erreichen.
Das Ganze liegt wohl daran, dass – wie der Semiotiker R. Barthes einmal sagte – ‚le sex est partout sauf dans le sex‘, was man über-setzen könnte mit: ‚der eigentliche Sex ist nicht der geschlechtli-che‘. Dies war ja auch Freuds Auffassung. Freud spricht vom Se-xuellen und seiner Sexualtheorie. Jedoch meinte er damit ein ‚in-fantil Sexuelles‘, etwas, das in der Kindheit vorherrscht und ledig-lich den Charakter des aus dem Erwachsenenleben abstrahierten Sexuellen hat. Diese Auffassung hatte zwei Gründe. Erstens war der typische Charakter, die Art und Weise eines Triebanspruchs und dessen Abfuhr gemeint, indem solches den Geschehen bei der Befriedigung eines Bedürfnisses gleicht. Hunger- und Durstgefühl müssen auch durch Nahrungsaufnahme befriedigt und deren Span-nung abreagiert werden. Zweitens war der Begriff des Sexuellen von Freud auch provozierend gemeint.
Eine Provokation weckt die Geister mehr als eine rein nüchterne, wissenschaftliche Feststellung. Insbesondere tat dies eine wissen-schaftlich hintermauerte Provokation. Hinter den großen Idealen der meisten Menschen steckten auf einmal nur Geltungs- und Be-friedigungswünsche, und so waren gerade die Personen gemeint, die sich für Herrn hielten, aber doch Knechte waren. Hegels Dia-lektik war gelöst. Auch der Knecht wäre gerne Herr gewesen und buhlte um Anerkennung. Den wirklichen, großen, souveränen Herrn jedoch gab es gar nicht. Auch der Liebhaber war nur von seinen infantilen Wünschen getrieben, und die Geliebte glaubte, je mehr sie begehrt würde, desto mehr wäre sie Frau, universale Frau. Doch auch diese gibt es im Grunde genommen nicht. Bei Lacan steht dies in jedem dritten Satz.
‚D i e Frau existiert nicht‘, war seine Standartaussage und die ita-lienische Presse, die von Lacans Vortrag in Mailand berichtete, schrieb: ‚per il dottore Lacan le donne non esistono‘ (für den Dr. Lacan existieren die Frauen nicht‘). Lacans Bonmot war freilich falsch verstanden worden. D i e Frau, D i e, sollte heißen, als uni-versal Festzulegende existiert sie nicht. Was der Mann ist, ist schnell gesagt: er ist der, der eine Bierflasche mit der Seite des Zeigefinders öffnen kann, sich für schnelle Autos und Fußball in-teressiert, usw. Das heißt, wohl die meisten Menschen würden in etwa das Gleiche dazu assoziieren. Aber die Frau ist vielschichti-ger. Man kann sie nicht einmal mit tausend verschiedenen Zu-schreibungen definieren. Sie kann die biedere Hausfrau sein, die femme fatal, Madame, Fee, Hexe, raffiniertes Weib, Mutter und wie gesagt zahlreiche mehr. Natürlich kann der Mann auch durch einen Beruf und anderes bezeichnet sein, aber dann ist er nicht mehr d e r Mann, d e r, der auf ein typisches Merkmal festgelegt werden kann.
Zu Frau dagegen assoziieren die Menschen die verschiedensten Bilder. Nun lässt Freud bekanntlich seine Sexualtheorie und die damit zusammenhängende Theorie des Ödipuskomplexes um den ‚toten Vater‘ kreisen. Auch hier gilt das Gleiche, dass d e r Vater, d e r per se, nur im Jenseits zu finden ist. Und so wird es auch wohl mit d e r Frau sind, nur ist sie nicht zu finden, sie wird aber ständig gesucht. Im endgültigen Sex würde man sie vielleicht fin-den, doch wird dieser durch den geschlechtlichen Sex immer wie-der durcheinandergebracht. Der geschlechtliche Sex – das zeigt sich am besten in Goethes Faust – ist so gesehen ein Fehlgriff, ein Patzer, ein ständiges Misslingen. Faust ist so impotent, dass er als Sexualtherapeuten den Teufel benötigt, der ihm Gretchen ver-schaffen soll. ‚Vor anderen fühl ich mich so klein; ich werde stets verlegen sein‘, jammert Faust, so dass Mephisto ihm einen Liebes-trank brauen muss, der so stark ist, dass Faust damit ‚Helena in je-dem Weibe sehen wird‘. Schließlich genügt aber eben Gretchen.
Die Frage Gretchens ‚wie hältst du´s mit der Religion‘ soll ihr die Sicherheit geben, dass Faust sie nicht einfach so verführen wird, doch die Macht der Pille (heutzutage Viagra statt Mephisto) ist stärker. Zwar beschreibt Goethe nicht den eigentlichen Akt so wie es heute moderne Autoren tun, die dann manchmal den Preis für die misslungenste, skurrilste und dümmste Beschreibung des sexu-ellen Vorgangs bekommen. Man kann ihn nämlich nicht beschrei-ben, es wird immer eine komische, alberne und danebengehende Metapher werden. Doch auch Fausts Beziehung zu Helena wird nur zur Allegorie von Antike und Mittelalter. Die beiden haben zwar einen Sohn gezeugt, doch um den ist es bald geschehen und damit verschwindet auch Helena. Was bleibt, ist der Dichter.
Der endgültige Platz des oben genannten Jemand kann jedoch auch er nicht endgültig besetzen, und um ihn zu etablieren, muss man also über die oben genannten Dialektiken hinausgehen. Es muss gelingen, eine Dialektik des Körpers selbst zu schaffen, in der das Echo ein Gedanke, ein Wort ist, das man hören, wahrnehmen kann um es von sich aus sprechen zu lassen. Der Jemand bleibt dann eigentlich unbestimmt. Er ist vielleicht nicht gerade ein Niemand, aber etwas dazwischen, indem somit die dialektische Kluft offenbleibt. Ich habe ihn NEM-O-NEO genannt, weil darin - lateinisch – mehrere Bedeutungen dieser Thematik stecken, und man sich somit für keine entscheiden kann. Aber er selbst ist benannt (genauere Hinweise über die Natur und Anwendung dieses Namens ist unter den Begriff Formel-Wort auf der Webseite www.psychocatharsis.com zu finden).