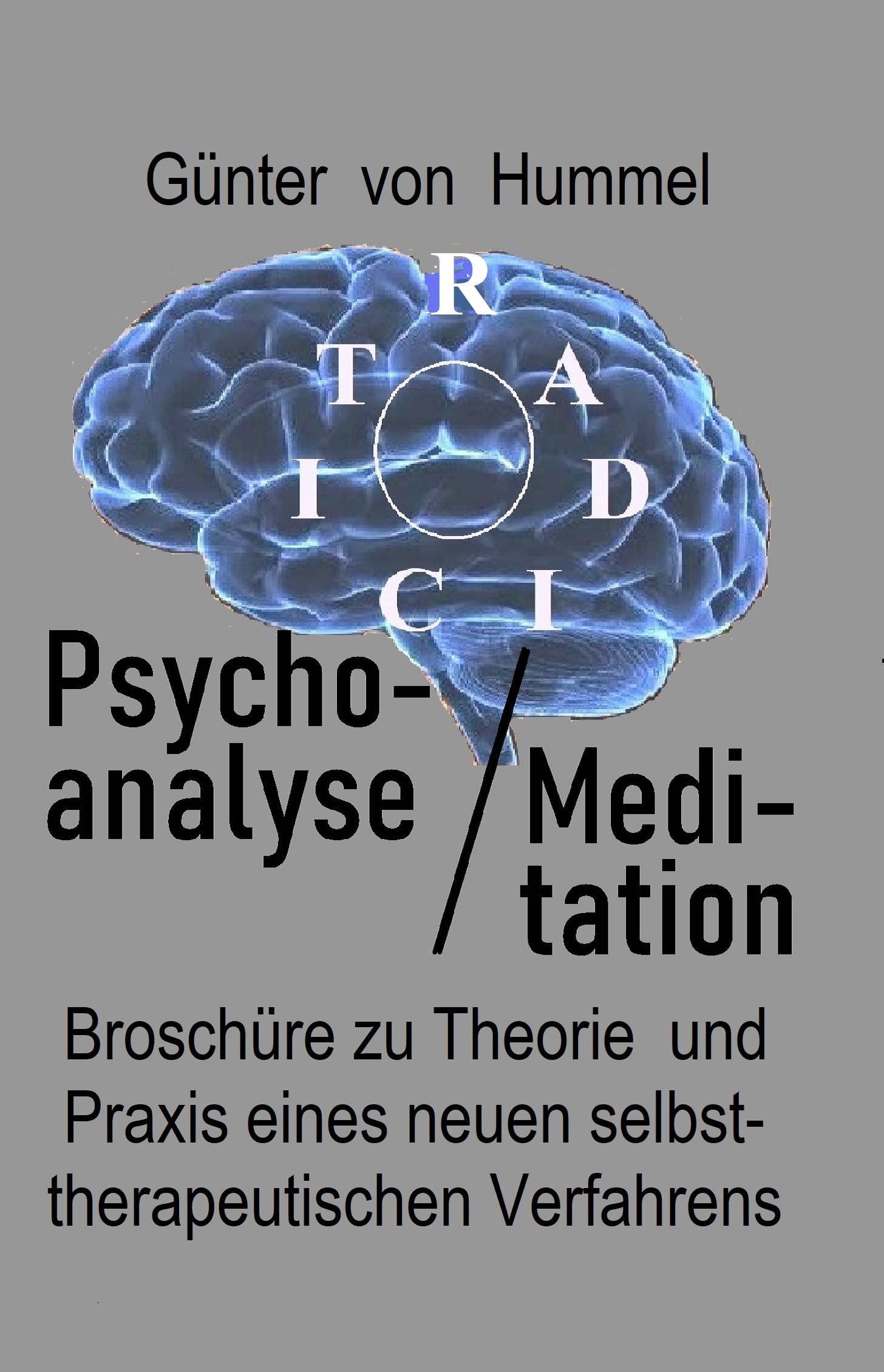In meinem Buch ‚Das konjekturale Denken‘ beschrieb ich dieses – sozusagen vermutungswissenschaftliche – Denken als eine Kombination aus dem üblichen, ‚gerichteten‘,ans Normal-Sprachliche gebundenen Denken und einem eher als ‚Nichtdenken‘ zu beschreibenden Zustand. Mit Nichtdenken ist nicht vollkommene Unbewusstheit gemeint, sondern ein Zustand der Aufmerksamkeit, jedoch ohne bestimmte Gedanken, also eine Art der Kontemplation. Es handelt sich genau um den Zustand, den der Psychoanalytiker einnehmen muss, wenn er den „freien Assoziationen“ seines Patienten zuhört. S. Freud sagte, dass der Analytiker dabei mit „gleichschwebender Aufmerksamkeit“ zuhören sollte. D. h., der Analytiker denkt nicht (oder vorwiegend nicht), ist aber wach und auf Aussagen des Patienten hin orientiert, befindet sich aber dennoch fast wie in Trance.
Der Philosoph P. Sloterdijk hat diesen Vorgang eine „Einheit von Wachen und Denken“ genannt und auf das griechische Wort sophronein (sich besinnen) zurückgeführt. So habe auch der Philosoph M. Heidegger versucht, das „Philosophieren wieder in den ‚vorsokratischen‘ Zustand zurückzuversetzen, in dem . . diese Einheit von Wachen und Denken noch möglich war.“[1][1] Sloterdijk nennt es auch eine „prokunfuse Einheit“, weil das spätere abendländische Denken ohne Wachen genau sowie das östlich-asiatische Wachen ohne Denken nur Konfusion hervorgerufen hat. Neben Heidegger erwähnt Sloterdijk auch Foucault und F. v. Weizsäcker, die dem „paradoxen Ideal eines Präsokratismus auf der Höhe des zeitgenössischen Wissens am nächsten gekommen seien.“ Doch wurde F. v. Weizsäckers Werk Zeit und Wissen „von der Öffentlichkeit wie von der Zunft ignoriert, auch von denen, die von sich nicht der Meinung sind, sie amüsierten sich zu Tode.“
Hier noch ein anderes Beispiel, um das konjekturale Denken, dieses meditative Denken zu erklären: Der etwas verrückte Szene-Guru der 70ger und 80ger Jahre, Bhagwan Rajneesh, machte manchmal – trotz seiner sonst recht esoterischen Grundhaltung – ganz pfiffige Bemerkungen. So sagte er z. B., dass er in seinen Ansprachen zwischen den Worten oft etwas längere Pausen mache. Nicht zu lange Pausen freilich, bei denen die Zuhörer hätten denken müssen, dass er jetzt den Faden verloren hat. Aber doch so lange, dass das Publikum noch in der zuhörenden Anspannung verblieb, also gleichermaßen noch die Ohren gespitzt hielt, die Aufmerksamkeit wach zum Redner hin gewandt blieb. Bei zu langen Pausen, aber auch bei zu kurzen oder gar keinen Pausen, fangen die Leute nämlich an, sich selbst Gedanken zu machen. So aber verblieben sie in einem Nichtdenken, in einer Art von Meditation. Während einer halbstündigen derartigen Ansprache hätten – so der Guru – die Zuhörer also schon ca. sieben Minuten meditiert (und 23 Minuten „gerichtet“ zugehört). Und die Vermittlung von Meditation war ja sein Anliegen.
Während des Zuhörens verbleibt man bei einer derartigen Rhetorik also in einem „gerichteten“, auf das Sprachlich-Logische orientierten Denken und wechselt in den Pausen wieder kurz auf ein Nichtdenken, auf die „gleichschwebenden Aufmerksamkeit“, eine Art von Meditation oder Kontemplation, um dann wieder den normalen Gedanken zu folgen usw. Im Laufe der Zeit habe ich jedoch bemerkt, dass es besser ist, von zweierlei Denken zu sprechen. Schon Freud hatte die bewussten Gedanken von ‚unbewussten Gedanken‘ unterschieden, was jedoch irgendwie paradox klang. Es verhielt sich jedoch so, dass man aus den Träumen, die keine klaren Gedanken enthielten, doch durch anreichernde Assoziationen und deren Deutungen etwas herausziehen konnte, das man einen dem Traumgeschehen zugrunde liegenden Gedanken nennen musste. Die ‚unbewussten Gedanken‘ splittern sich in Bilder und Anspielungen, in Synekdochen und Metonymien und anderen stilistischen Formen auf, die durchaus Sprachcharakter haben, aber keinen klaren, ‚gerichteten‘ Gedanken formulieren können.
So gesehen ist es vielleicht einfacher und geeigneter vom bewussten und unbewussten Sprechen zu reden. Im bewussten Sprechen wird das eigentliche Denken, das ich also nach wie vor gerne das ‚konjekturale Denken‘ nennen würde, ,gerichtet‘, an syntaktischen und grammatikalischen oder lexikalischen Elementen ausgerichtet, strukturiert. Es ist das Sprechen der Kommunikation, der politischen Verwendung, des Verstehens. Das unbewusste Sprechen dagegen ist das des Enthüllens, des Begreifens, der Wahrheit. Die Struktur dieses Sprechens kann nicht gesagt und mitgeteilt werden in den Vokabeln der bewussten Diskurse. Eben da liegt ja die Schwierigkeit einen Konsens herzustellen. Diesbezüglich kann man sich nur auf das Konjekturale, auf die Vermutungswissenschaft stützen, bei der man sich mit immer genaueren Vermutungen der letztlichen Gewissheit nähert, in der die Wahrheit gewusst werden kann.
Das bewusste Sprechen hat es bereits bei den Frühmenschen gegeben. Seine ersten Verlautungen waren solche Losungs- und Identitätsworte,[2][2] die noch wie reine Signifikanten wirkten. Dem Sprachwissenschaftler F. de Saussure zufolge ist der Signifikant ein „Schema von Gegensätzen“, die für den Menschen nicht aushaltbar sind, so dass er zu einem “Lautbild“ greifen muss, um sich auszudrücken und zu entlasten. So kann z. B. ein „Lautbild“-Erlebnis für eine Gruppe von Menschen zum Identitätswort (Losungswort) werden. Mehrere solcher Signifikanten aneinandergereiht machten die Verlautungen des Frühmenschen aus, vermittelten seine „Spreche“, aber auch sein „Denken“. Denn das hing noch alles sehr eng zusammen. Er selbst war der große, zottelige Tiermensch, und wenn er einen anderen traf, und sie sich beide mit den gleichen Urlauten anriefen,[3][3] dann waren sie sich als Menschen einig. Damals genügten noch ein paar Laute, um die ganze Welt in Eins zu packen.
Der Neandertaler zum Beispiel besaß eine primär-primitive, aber bereits ideale Kombination dessen, was ich das Strahlt / Spricht nenne, eine Kombination des schau- und Sprechtriebs wie es die Psychoanalytiker theoretisieren. Der Neandertaler konnte noch keine Verschluss- und Knacklaute bilden, [4][4] aber Vibrationslaute, Plosive und einfache Frikative und bestimmte Vokale, evtl. auch einzelne Konsonanten (sogenannte Klosanten) auszudrücken war ihm möglich. Zudem – oder in Verbindung damit – konnte er von der Situation unabhängige Symbole artikulieren und damit vieles klar geordnet sagen, aber er tat dies tonhafter, singartiger, mit mehr Atemtechnik, mit Lufthervorstossungen und mit wenig Kehlkopf, wie man aus entsprechenden Untersuchungen der Kehlkopfknochen, der Sprachgene und ein paar anderer Hinweise eruiert hat. Er redete schlichter, insbesondere was alltägliche Verrichtungen betraf, jedoch wesentlich zeitintensiver, was komplexere Zusammenhänge anging. Er konnte also generell nicht viel sagen, und so entwickelte sich das Sprechen durch das Eintreffen des modernen Menschen in zwei Richtungen auseinander.
Einerseits fand sich nun das lexikalische, bewusste Sprechen, das sein Strahlt und seine Enthüllungsfunktion weitgehend verloren hatte, und das auch heute noch unser Allerweltsdiskurse bestimmt. Unser sogenannt logisches Denken ist damit nur vordergründig logisch, es besitzt keine Fuzzi-Logik, wie es B. Kosko beschrieb.[5][5] Dafür aber konnten wir mit ihm unsere moderne Technik aufbauen, konnten wir komplexe philosophische Gebäude entwickeln und stets so reden, dass es aussah, als würden wir uns alles sagen was in uns vorgeht. Wir verstehen uns so prächtig, auch wenn wir nichts begriffen haben. Nun noch versteckt in den Träumen lauert das unbewusste Sich-Ausdrücken, das Hinausdrängen der Wahrheit, die Wonne des wahren Begreifens, in dem Rhythmisches und Spiegelndes eine wichtige Rolle spielen.
Die Psychoanalytikerin D. Birksted-Breen hat diese Spiegelstadium – Erfahrung durch diese andere, gleichwertige und gleichwichtige und mehr linguistische bereichert. Sie sagt, dass in der menschlichen Psyche neben meist unbewusst ablaufenden Spiegelungsprozessen auch sogenannte "Widerhalleffekte" eine wichtige Rolle spielen. Der "Widerhall" ist wie der vom Linguisten F. de Saussure gefundene Signifikant[6][6] ein lautlicher „ Prozess von Gegensätzen“, von seelischen Echovorgängen, indem er zwischen Mutter und Säugling (Kleinkind), nämlich zwischen dem Reverie-Geplapper der Mutter und eben dem "widerhallenden" Antworten des Kindes entsteht. Es findet also eine erste Hall –Widerhall, Anklang / Widerhall oder Signifikanten-Kombination statt, die noch keine ausgereifte Sprache darstellt, dennoch aber schon symbolische Grundlage hat.
Und noch dazu: diese Grundlage ist auch real! Es verlautet etwas, und in diesem Hin und Her der Verlautungen entsteht ein erstes Identitätsgefühl zwischen Mutter und Kind. Ja mehr noch, es entsteht ein Identitätsklang, eine Art eines ersten Losungswortes wie es den Anfang der Menschheit charakterisierte, wenn es auch vorerst nur Klänge, Laute und Vokale sind, aus denen dieses Wort-Klang-Widerhall-Geschehen besteht. Schon der Säugling kann sogar meist die rhythmische Lautfolge wiedergeben, die ihm vorgelallt wurde, dieses erste Es, Da oder Das also bestätigen, anerkennen.[7][7] D. Birksted-Breen zeigt Fälle auf, an Hand derer sich ganz klar nachweisen ließ, dass Menschen, denen diese Fähigkeit fehlt, nicht träumen können und daher auch meist schwere Schlafstörungen und psychische Probleme haben.
In einem seiner letzten Seminare sagte Lacan: „Weil der Körper einige Öffnungen hat, deren wichtigste, weil es nicht verstopft, geschlossen werden kann, das Ohr ist, antwortet im Körper das, was ich eine Stimme genannt habe.“ [8][8] All die Laute, Klänge, Töne, die in uns unaufhaltsam eingedrungen sind, erzeugen diesen nostalgischen Widerhall, diesen heimatlichen Gesang lang vergangener Tage und deren sirenengleiche Süße. Das Kind braucht diese Widerhalleffekte um Erlebtes zu verarbeiten, und es weiß auch schon ganz genau, dass es dies am besten nur mit sich alleine tut, wenn es abends seine Monologe hält, die es sofort abbricht, wenn jemand in sein Zimmer kommt. Dieses unbewusste Sprechen bekommt so eine melodische Erinnerung und Stimmigkeit, denn es ist die Stimme, die vom Körper aufgerufen ist und von ihm her antwortet.
Das unbewusste Sprechen kann keine juristischen Diskurse abhalten, es kann aber die Wahrheit preisgeben, kann uns das wahre Begreifen zeigen, das intim Gefühlte. Mehr und mehr wird so ersichtlich, dass wir beide Arten des Sprechens in eine gemeinsame Art verbinden müssen, so wie schon beim Denken beschrieben: dem konjekturalen Denken, das aus dem logisch ‚gerichteten’ und dem fuzzi-logischen, dem fast Nicht-Denken besteht, muss eben ein konjekturales Sprechen korrelieren, das sich aus den zweierlei und ähnlichen strukturierten Komponenten des bewussten und unbewussten Sprechens zusammensetzt. Denken und Sprechen gehen ja Hand in Hand, und so erhebt sich genau hier die Frage, wie man dies lernen kann.
 Nun, man muss den Knoten zu knüpfen und aufzuknüpfen erlernen, der diese elementare Verbindung darstellt. Lacan hat sich aus diesem Grund mit der Topologie, der Einsteinschen Geometrie, die auch Gummigeometrie genannt wird, beschäftigt. Das Möbiusband,[9][9] der Torus und andere Figuren dieser Wissenschaft zeigen Flächen und Linien, die sich überkreuzend durchschlingen und so das beste Modell für das zweierlei Sprechen ergeben. Die Abbildung links zeigt das von mir in mehreren Büchern verwendete Möbiusband mit darauf geschriebenen Buchstaben. Man kann die Buchstaben in einem einzigen Wortzug lesen, und weil das Band keine Endstelle mehr hat, fängt man beim Lesen immer wieder von vorne an. Trotzdem kommen bei dieser Art des Lesens immer wieder andere Bedeutungen heraus, wenn man von verschiedenen Buchstaben anfängt.
Nun, man muss den Knoten zu knüpfen und aufzuknüpfen erlernen, der diese elementare Verbindung darstellt. Lacan hat sich aus diesem Grund mit der Topologie, der Einsteinschen Geometrie, die auch Gummigeometrie genannt wird, beschäftigt. Das Möbiusband,[9][9] der Torus und andere Figuren dieser Wissenschaft zeigen Flächen und Linien, die sich überkreuzend durchschlingen und so das beste Modell für das zweierlei Sprechen ergeben. Die Abbildung links zeigt das von mir in mehreren Büchern verwendete Möbiusband mit darauf geschriebenen Buchstaben. Man kann die Buchstaben in einem einzigen Wortzug lesen, und weil das Band keine Endstelle mehr hat, fängt man beim Lesen immer wieder von vorne an. Trotzdem kommen bei dieser Art des Lesens immer wieder andere Bedeutungen heraus, wenn man von verschiedenen Buchstaben anfängt.
Ich glaube, dass man kein besseres Abbild, keine zutreffendere Darstellung des letztlichen Realen finden kann, als ein derartig verknotetes Band. Doch darin liegt nicht der eigentliche Coup. Denn es ist ja überhaupt nicht klar, wie man mit so etwas ‚konjektural sprechen’ können sollte. Nun ist verständlich, dass man beim ‚konjekturalen Sprechen’ nicht nur selbst, sozusagen vom einen Ich aus spricht. Vielmehr muss Es auch mit am Sprechen beteiligt sein, Es, das Freudsche Es oder einfach eben das Unbewusste. Aus den ‚Widerhalleffekten’, aus den ‚Urlauten’, aus dem ‚monadischen Klang’ heraus muss ebenso ein Beitrag zum Sprechen festzustellen sein. Mit anderen Worten: man müsste wie ein Neandertaler etwas hervorstoßen, singartig und fuzzi-logisch, und doch auch normal-sprachlich, syntaktisch klar. Aber wie soll das gehen?
In der klassischen Psychoanalyse funktioniert das so, dass man die unbewussten Gedanken aus verschiedenen Fehlleistungen, Versprechern, Träumen und Phantasmen herausfiltert und diese dann als eben unvermeidliche, weil triebgestützte Gedanken dem üblichen Alltagsdenken zumischt. Das geschieht jedoch alles sehr stark an das lexikalische und ‚gerichtet’ logische Denken angelehnt, so dass das Ganze zwar geklärter, einsichtiger und gereifter ins psychische Leben integriert werden kann. Es bleibt jedoch ein sehr sachlicher, manchmal pessimistischer, ernsthafter Zug bestehen. Jubilatorische Erfahrungen sind eher selten und stellen selbst dann noch ein narzisstisches Gehabe dar, so wie es bei einem der Pioniere der Psychoanalyse, S. Ferenczi, besonders der Fall war. In der Methode der Analytischen Psychokatharsis sind die Dinge anders und vorteilhafter zu erfahren.
Ich muss dieses Verfahren hier nicht nochmals detailliert erklären. Es findet sich auf dieser Webseite mehrfach dargestellt. Es ist auch hier so, dass man Gedanken aus dem Unbewussten ins Bewusste integrieren muss, doch diese Gedanken sind schon rein strukturell vorgeformt, man muss sie nicht mühselig durch zahlreiche Deutungsmanöver erarbeiten. In einigen meiner Bücher habe ich vom ‚Gedankenhören‘ gesprochen. Doch es muss nicht immer ein inneres Hören sein, die Gedanken können auch wie aus der Tiefe oder ferne und wie fremd erscheinen, werden aber doch meist sofort als eben auch eigene Gedanken erkannt. Das Befremdliche ist dem Unbewussten zuzurechnen, dem Fuzzi-Logischen, aber eben auch dem Wahren, dem Zutreffenden, und darauf kommt es an.
(Wird fortgesetzt)
[1][1] Sloterdijk, P., Du musst dein Leben ändern, Suhrkamp (2009) S. 272 - 275
[2][2] Im Gegensatz zu vielen Linguisten betont J. Lacan, dass das Sprechen nicht durch die lautliche Bezeichnung einzelner Dinge in Gang kam, sondern durch Losungsworte. Dies bestätigt auch der Sprachforscher H. Haarmann (Weltgeschichte der Sprachen, Becksche Reihe, S. 32), indem er die Identitätsfindung als die Ursache der Sprache auffasst. Ein Losungswort ist ein Identitätswort.
[3][3] Es soll sich neuesten Meldungen zufolge um ein „singendes“ Sprechen gehandelt haben.
[4][4] Das Tier kennt nur eine Signalsprache, keine vollständige Symbolsprache, in der die Worte von jedem Handlungsbezug vollständig entkoppelt sind. Siehe z. B. die Bemühungen, Schimpansen das Sprechen beizubringen bei R. Fouts, Unsere nächsten Verwandten, Limes (1998), wo der Autor beschreibt, wie er zwar eine große Anzahl von Worten den Schimpansen übermittelt, aber sich nicht ein selbstständiges unabhängiges Gespräch entwickelt. Der Neandertaler kannte jedoch die Symbolsprache.
[5][5] Kosko, B., Fuzzi Logisch, Eine neue Art des Denkens, Carlsen Verlag (1993)
[6][6] Hier ist der Signifikant, dieser „unscharfe Bedeuter“, noch stark an die Linguistik gebunden, erst in der Psychoanalyse wurde er zu etwas, das dem Trieb selbst nahesteht.
[7][7] S. Freud sprach hier vom ES, die Daseinsanalytikerin C. Spitzer vom Da des Anklangs / Widerhalls und der Psychoanalytiker D. Symington vom Das, von der ‚Thathood’ (Dasheit) des Zwischenmenschlichen.
[8][8] Lacan, J., Seminar XXIII, Lacan-Archiv, Seite 10
[9][9] Ein Band, das um 180 Grad gedreht und so an den Endstellen zusammengeklebt wird, dass es nunmehr nur noch eine Fläche hat, obwohl es auch Vor- und Rückseite gibt (siehe Abbildung).