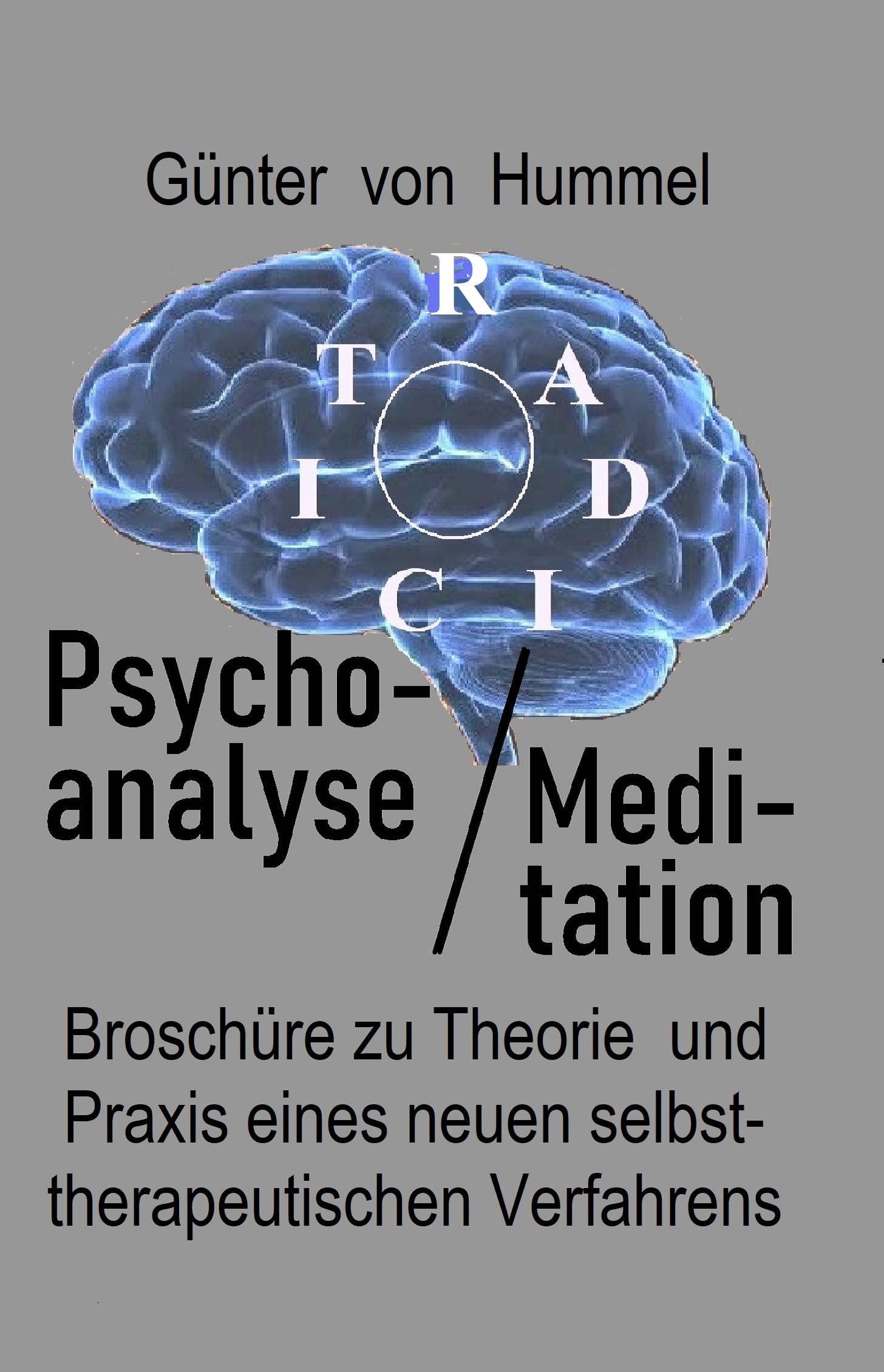I. D. Yalom, der große Psychotherapeut und „begnadete Geschichtenerzähler“ hat jetzt auch noch als wohl vorläufig letzte Geschichte seine Autobiographe geschrieben. Freud meinte ja, das Biographieschreiben sollte man anderen überlassen, die Gefahr dass man seinem Narzissmus verfällt ist zu groß. Nun ist Yalom tatsächlich ein besonderer Fall der Psychotherapiegeschichte. Kaum einer aus seinem Metier ist in den dreißig Jahren so bekannt geworden, kaum jemand hat in ähnlicher Weise auch nur annähernd so viele Bücher geschrieben und kaum jemand ist so viel unter Kollegen, Institutionen, Veranstaltungen, Leserreisen und Würdigungen herumgekommen. In seinem Buch ‚Der Panama-Hut‘
gesteht er demnach auch ein, dass er sich Gedanken macht, ob er wirklich ernst genommen wird, und dass er aus diesem Grund dieses Buch schreibt. Dazu muss man wissen, dass er von Anfang an zwar eine Universitätskarriere im psychiatrischen Bereich angestrebt und auch zum großen Teil bewältigt hat, aber im psychotherapeutischen Bereich aber die recht lockere, intuitive, vertraulich-kumpelhafte Rolle mit sich und seinen Patienten einnahm.
S. Freud, C. G. Jung und Lacan sah er als zu starke Reglementierer, Systematiker und sich zu wenig mit den Patienten verbrüdernde Psychoanalytiker an, und schiebt dies auf seine eigenen Erfahrungen mit einer recht kühlen, meist distanzierten und sachlich argumentierenden Lehranalytikerin. Mit Sicherheit hat es von Lacan nicht viel gelesen, denn wer als Psychotherapeut in Lacans frei gehaltenen Seminare hinein liest und damit also doch einiges versteht, wird sich dessen brillanter Intellektualität und logischer Praxis nicht entziehen können. Obwohl Yalom sich auch mit erheblich Persönlichkeitsgestörten und nicht nur schwachen Neurotikern beschäftigt hat, fehlt ihm oft eine Gefühl für den Ernst der Sache. Ich weiß nicht mehr in welchem Buch er die Geschichte des Patienten erzählt, der wohl eine solche ausgeprägtere seelische Störung hatte und sich in der Klink immer auf ein Podest setzte, um den Herrscher oder König zu spielen. Der Therapeut machte dann folgenden Therapieversuch: er kniete vor dem Podest nieder, hielt der Schlüssel der Klink angehoben in der Hand und sagte, dass er diesen nun ihm übergeben wolle. Der Patient soll dann wieder nach langer Zeit zum ersten Mal etwas gesprochen habe: „Hör auf, einer von uns muss ziemlich verrückt sein.“
Erfahrungsgemäß geht so etwas meistens jedoch schief aus. Auch die Patienten wollen nämlich ernst genommen werden, fast immer sogar sehr ernst. Die Wahrscheinlichkeit, dass solch eine Szene zu persönlich, zu ironisch, verhöhnend und veralbernd wirkt, liegt auf der Hand. Es geht eben in der analytischen Psychotherapie nicht immer mit der kumpel- und komplizenhaften Art gut. Selbst guter Humor muss so vermittelt werden, das der Patient ihn annehmen kann. Ernsthaft zuhören ist grundlegend, behutsame Interpretationen geben oft notwendig, aber ständiges Plaudern, sich freundlich unterhalten und Schulterklopfen reichen nicht aus. Auch in der neunen Autobiographie schildert Yalom gleich am Anfang die Therapiestunden mit einem Patienten, der – trotz einer Auszeichnung – mit seiner beruflichen Identität hadert. Yalom erzählt ihm – den manchmal stockenden Therapieverlauf überbrückend – die Geschichte eines ähnlichen Vorgangs bezüglich einer Auszeichnung bei seiner Schulabschlussfeier. Der Patient lacht darauf „schallend und murmelte: ‚Ein Therapeut nach meinem Geschmack.‘ Na ja, wenig eitel ist er nicht..
Ja, das war Yalom wahrscheinlich immer. Er wollte geliebt werden und wurde geliebt. Er war der richtige Sonny-Boy, der „effektiv“ arbeitete und eben nicht nach starren Regeln. Aber die Effektivität ist in der psychoanalytischen Arbeit schwer zu beurteilen. Darüber gibt es ausführliche Studien, Langzeitbeobachtungen und Nachbefragungen, aber der generelle Tenor ist der, dass man aus der analytischen Psychotherapie zwar oft erleichtert, verständnisvoller, innerlich etwas gereifter, aber bei Weitem nicht geheilter herauskommt. Schon gar nicht glücklich wie Yalom oft Gruppentherapieergebnisse beurteilt. Au dem Gebiet der Gruppentherapie hatte er sich einen Namen gemacht und auch ein Buch darüber geschrieben. Nun gehen Gruppentherapien nie so in die Tiefe, wie es in den Einzeltherapien der Fall ist, und da liegt ein Problem.
Denn ich glaube, dass Yalom dieses Problem nicht gelöst hat und deswegen angefangen hat, mit Romanen darüber hinweg zu schreiben und auch den Versuch unternahm, mit dem Titel der „existenziellen Psychotherapie“ wieder seriöseres Terrain zu betreten. Doch so etwas wie seine „existenzielle Psychotherapie“ führen auch viele Philosophen durch. Diese Therapieform stützt sich nämlich auf die Annahme, dass vier Grundaspekte: Tod, Einsamkeit, Sinn des Lebens und Freiheit als Ausgangspunkte jeder Therapie gelten können. Jeder Mensch und speziell jeder Patient würde sich mit diesen existenziellen Fragen beschäftigen und von da aus kann er auch geheilt werden. Doch die meisten Menschen beschäftigen sich natürlich im Alltag nicht mit diesen Aspekten. Sie schlagen sich mit ihren privaten und beruflichen Beziehungen herum, mit Eltern, Kindern, Arbeitgebern, Freunden und Kollegen. Lediglich Philosophen oder Personen, die darüber viel gelesen haben und freilich auch einmal ein psychisch Kranker, der diese Thematiken zum Inhalt seiner Projektionen oder Paranoia gemacht hat, fällt unter diesen Aspekt, dass er sich zu viel und zu intensiv mit dem Tod oder dem sogenannten Sinn des Lebens abgibt.
Was Yalom eigentlich gemacht hat, würden wir – hier in Deutschland zumindest – als „tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie“ bezeichnen, und so wird es auch von den Krankenkassen eingestuft. Es handelt sich um eine Gesprächstherapie, die kaum analytisch ausgerichtet ist, sondern mehr stützend und suggestiv vorgeht. Dabei können durchaus auch derartige Aspekte wie der Tod eine Rolle spielen, meistens jedoch eher Alltags—und Beziehungsprobleme. Ein richtiger Psychoanalytiker war Yalom wohl nie und musste er ja auch nicht sein. Seine Therapieschilderungen in den Romanen gehen allerdings in eine ganz andere Richtung. Sie sind oft sehr überzeichnet, burlesk (wie er selber sagt), konstruiert, sexistisch und märchenhaft. In den achtziger Jahren des letzten Jahrhundert waren sie alle Renner, obwohl mich in dem über fünfhundert Seiten langem Roman „Die rote Couch“ gleich die erste Geschichte an den Marquis de Sade erinnerte. Die Patienten Belle heißt nicht nur so, sie ist auch in jeder Richtung extrem: Schönheit, Sexappeal, Alkohol, Drogen, femme fatal, rausch- und zwanghafte Verführerin, dann jedoch auch wieder superclean, topfit, willensstark und vieles andere mehr.
Der Therapeut ist superschlau, er weiß, dass ihre Besserung nur eine „Übertragungsheilung“ ist und unternimmt daher zahlreiche verhaltenstherapeutische Aktionen, ja schließt quasi einen Pakt mit dem Teufel wie es Goethes Faust nicht besser konnte, so dass am Schluss ein deus ex machina auftreten muss, der in Form eines Staatsanwaltes dazwischen funkt. Auch sonst wird viel von überbordendem Sex, Masturbationsphantasien bei Therapeut und Patientin, Wut, Lügen, Tricks, Aggressivität, Sucht, Selbstmord, Missbrauchsgedanken und entsprechendes Fehlverhalten des Therapeuten und geredet. Yaloms Bücher sind Psycho- und Sexkrimis, ich konnte keinen bis zum Ende lesen, weil ich das Gefühl hatte, es geht immer um dasselbe. Nun ist er aber zurecht eine Galionsfigur, Erzähler psychologischer Meistermärchen, Erfolgstyp, ein Kulturmensch, an dem man sich abarbeiten, Streitdiskussionen führen, und sich noch lange erinnern wird.