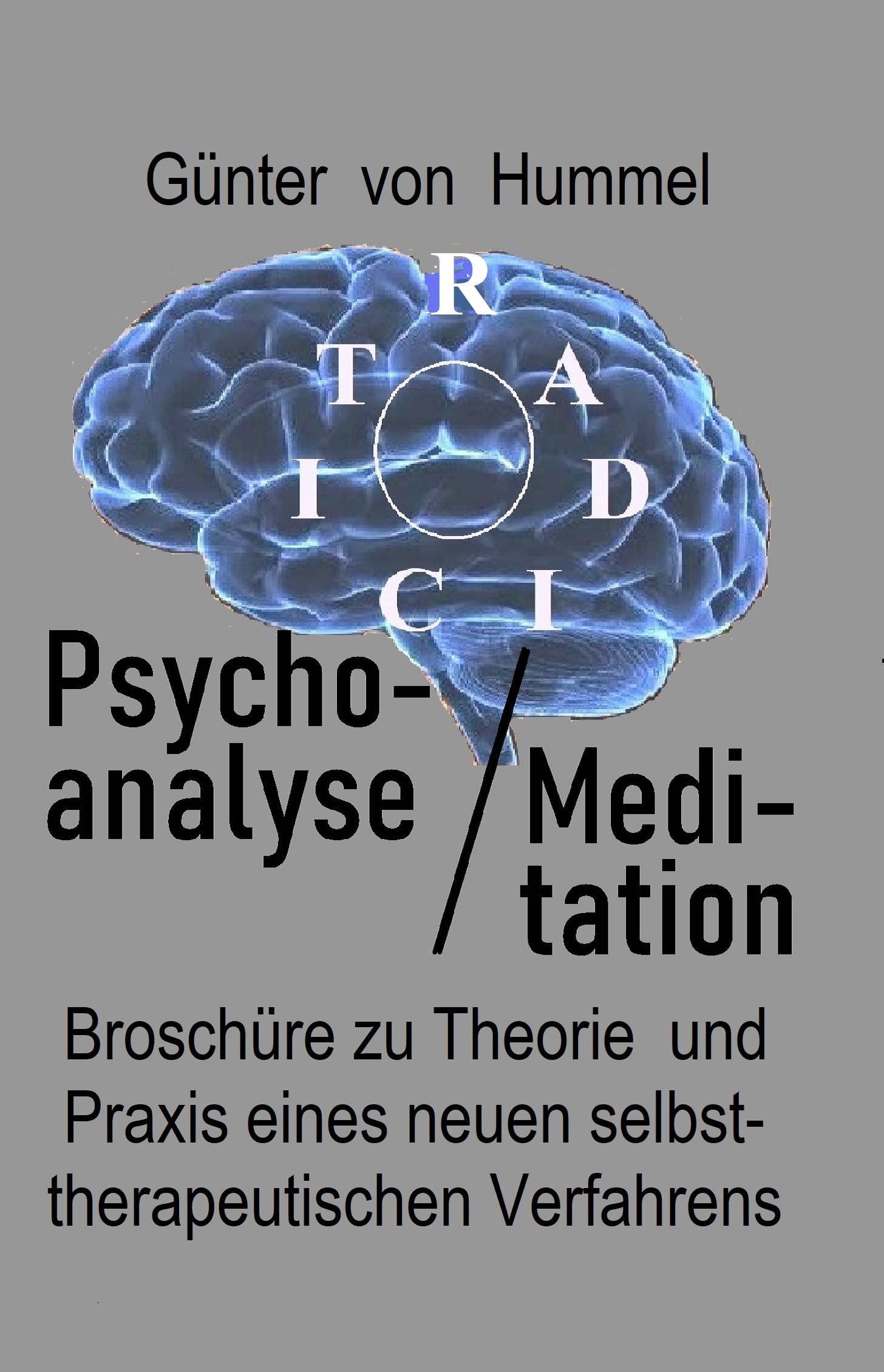In der FAS vom 12. 7. 2020 schrieb die Journalistin J. Schaaf über die Problematik lesbischer Paare und ihrem Kinderwunsch mit Hilfe schwuler Samenspender.(1) Die Frauen sind meist verheiratet und damit offiziell auch die Eltern des Kindes; in einen der geschilderten Fälle eines Jungen. Kurz nach der Geburt hatte der leibliche Vater zugestimmt, dass die Ko-Mutter den Jungen adoptiert. Damit hatte dieser jedoch auch seine Rechte am Kind verloren, was er anfänglich nicht befürchtete, da die Frauen ihm zugesichert hatten, sie wollen nicht nur einen Samenspender, sondern auch einen Papa für das Kind. Diese Konstellation lief jedoch schon bald nicht mehr so gut wie angekündigt. „Der Kontakt zwischen Vater
und Sohn wurden von den beiden Müttern streng überwacht und reglementiert“, schreibt Schaaf. Immer mehr verweigerten die Frauen dem leiblichen Vater seine Paparolle, so dass dieser das Familiengericht einschalten musste: ohne Erfolg. Sein Kind hat er nicht mehr gesehen.
Da diese Thematik wohl inzwischen sehr häufig zum Problem geworden ist, schrieben vier solcher Schwulen-Papas ein Ratgeberbuch.(2) In der Verlagsbeschreibung steht: „Die Texte erzählen von allen Aspekten von Vaterschaft, den Planungen, der Zeugung, der Schwangerschaft, Geburt, vom Umgang mit eigenen Kindern, dem Umgang mit den Müttern, was alles für die Partnerschaft oder das Singledasein bedeutet, und welche rechtlichen Aspekte eine Regenbogenfamilie bestimmen. Das Konzept der Regenbogenfamilie ist vielfältig: Es gibt nicht die eine Regenbogenfamilie. Egal, welche Vaterrolle man schließlich für sich definiert: Eine Familie zu gründen bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Die Kapitel des Buches bilden alle wichtigen Phasen von Vaterschaft von der Planung bis zu rechtlichen Aspekten ab. Die Kapitel bieten Erfahrungsberichte schwuler Väter, Interviews, Checklisten. Auch Mütter kommen zu Wort: Es ist wichtig zu sehen, dass es immer mehrere Perspektiven gibt“. Die ‚diverse Familie‘ wie sie auch heißt, hat nicht wenige Probleme.
Trotzdem, ein schwules oder lesbisches Paar, das verantwortungsbewusst, engagiert, privat, sozial und beruflich gut aufgestellt ist, wird auf jeden Fall die besseren Eltern stellen, als eine alkoholsüchtige Mutter, ein arbeitsloser Faulpelz als Vater und ein heruntergekommenes Zuhause dieses heterosexuellen Paares. Das tiefere Problem, z. B. aus psychoanalytischer Sicht betrachtet, gehen die Autoren des gerade genannten Buches aber nicht an. Es beginnt vielleicht schon damit, warum von den lesbischen Paaren besonders häufig schwule Männer als Väter herangezogen werden. Anscheinend gelten diese als nicht so dominanzstrebend, als weichere Verhandlungspartner, mehr linksliberal und nicht konservativ herrschsüchtig wie viele heterosexuelle Männer. Aber Väter wollen die schwulen Männer eben auch gerne sein und darin auch reüssieren, haben sie doch selbst meist einen schwachen Vater erlebt, vor dessen Liebe sie eher Angst hatten. Die Mütter ließen sie dagegen über sich herrschen. Die blieben die einzigen Frauen in ihrem Leben.
Darüber wissen schwule Männer meist selbst gut Bescheid, so wie auch heterosexuelle Männer wissen oder es zumindest müssten, dass sie pervers sind, wenn sie ständig eine andere Frau brauchen und noch viele weitere im Kopf haben. Jede Sexualität hat ihre Schattenseiten, und damit hängt wohl vieles der Problematik heutiger Beziehungen zusammen. Obwohl viel liberaler und toleranter, sind die Beziehungsverhältnisse, die ‚Beziehnisse‘,(3)nicht besser geworden. Sie sind zwar mehr ‚multilayered‘ als früher, aber zu viel ‚multi‘ ist auch schwierig. Wie der Psychoanalytiker A. Mitscherlich schrieb, hat dies damit zu tun, dass wir schon seit längerem in einer „vaterlosen Gesellschaft“ leben, was kein Wunder ist, nachdem in zwei Weltkriegen die Väter so fürchterlich versagt haben. Religion, Kultur und Wissenschaft bieten ebenfalls keine Richtlinie an, jedenfalls nicht effektiv genug. Doch – wie gerade erwähnt – man(n) will doch gerne Vater sein, und zwar ein guter, richtiger Vater. Nur, was ist das? Der Vater einer meiner Freunde soll gesagt haben, er erziehe seinen Sohn nicht streng, sondern ungerecht, weil die Welt eben so beschaffen sei. War das ein guter Vater?
Meiner war eher streng, Nazis waren sie damals ohnehin fast alle. Trotzdem bin ich letztlich mit ihm nach langen Kämpfen und gegen ihn gerichteten politischen Einstellungen ganz gut zurande gekommen. Mein Vater war allerdings schon von daher, dass er hundertzwei Jahre alt wurde, ein besonderer Fall. Denn allein das Alter machte ihn bewunderungswürdig, schließlich musste er auch in dieser langen Zeit (bis siebzig Jahre nach dem letzten Krieg) seine politischen Ansichten differenzieren und verbindlicher gestalten. Mehr und mehr konnte man mit ihm konstruktiv diskutieren. Zudem ermöglichte er mir reichlich Bildung, ein Studium, Unterstützung beim Hauserwerb und Alltagsklugheit. Trotzdem genügte mir all dies nicht. Ich musste noch eine psychoanalytische Ausbildung machen und mich mit Meditation beschäftigen, um in der Frage, was es heißt, wirklich Vater zu sein, weiterzukommen.
Auch Lacan hat mir geholfen. Da der Vaterbegriff angefangen von der Leiblichkeit einiger Spermatozoen über den Mythos eines göttlichen Urvaters bis zu all den familiären, sozialen, psychologischen, politischen, wissenschaftlichen und weiß Gott was sonst noch für Väter weit gespannt ist, hatte Lacan wie angedeutet lange Jahre an die Stelle seiner vor allem im Unbewussten wirkenden Instanz den ‚Namen des Vaters‘, den Eigennamen, das vaterbezogen Namentliche als solches ins Zentrum aller Zuschreibungen gesetzt. Denn das Unbewusste sei aufgebaut w i e eine Sprache, konstatierte er, und von daher lag es nahe der im bewussten Leben so wichtigen Muttersprache die eines im Unbewussten wirkenden ‚Vatersymbols‘ zur Seite zu stellen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Größen ließ sich psychoanalytisch schon seit Freud im Wesen des sogenannten Überichs zeigen.
So gilt das weiblich-mütterliche Überich eher als breit, vielschichtig angelegt und nicht so kontrolliert und bestimmend wie das männlich-väterliche. Man hat dies auch auf die Frühphasen der Menschheitsentwicklung zurückgeführt. Dort mussten sich die Väter gegenüber der weiblich-mütterlichen, matrilinearen Dominanz behaupten, was sie – wollten sie sich, abgesehen von der matristischen Liebhabergeschichte, nicht nur mit brutaler körperlicher Stärke durchsetzen – mit entsprechender Stimmbezogenheit tun mussten. So waren die ersten Worte Befehls- und Losungsworte. Der Vormensch kannte wie die Tiere nur eine Signal- und keine Symbolsprache. Wie im Vogelgezwitscher konnte er Lautsignale geben, doch außer dem Trillern von Liebesbegehren und Revieransprüchen war ihm keine Aussage möglich. Erst als er eine Lautfolge betont und bewusst wiederholen konnte, als er eine Regung, ein Erstaunen, einen Affekt mit der gleichen Lautsequenz noch einmal und dann wieder und wieder mit Betonung von sich geben konnte, war das Symbol, das erste Wort geboren.(4)
Die Lautfolgen im Vogelgezwitscher sind zwar nicht immer konsequent die gleichen, und selbst wenn sie dies sind, so werden sie nicht mit einer Art von Bedeutsamkeit, zunehmend ernsthafter Betonung und Bewusstheit vorgetragen. Aus der reinen Lautbildlichkeit ist beim Menschen eine Worthaftigkeit und Signifikanz geworden, die mit zunehmendem Verständnis perpetuiert werden konnte. Die erste Diskursform war somit eine Art der ‚Ein-Wort-Sprache‘, das Losungswort des ‚Herrensignifikanten‘ wie Lacan es dem Philosophen G. F. Hegel folgend bezeichnete. ‚Ich Herr, du Freitag‘ sagte Robinson zu dem Indianer, den er schließlich auf seiner einsamen Insel traf und demgegenüber er gleich die Verhältnisse durch eine derartige Setzung zu bestimmen versuchte. „Ich bin der Bestimmer“ (soll heißen der Vater) sagen die Kinder auch heute noch im Spiel, um die Regeln zu vereinfachen.
Diesen Beginn des Vater-Namens, -Symbols, der Vater-Metapher hat der Anthropologe C. Levy-Strauss in seinem Buch über die ‚elementaren Strukturen der Verwandtschaft‘ mit der Differenz von Natur und Kultur ins Spiel gebracht. Claude Levi-Strauss war der Ansicht, dass der Eigenname etwas ist, was ursprünglich vom Paten seinem Patenkind gegeben wurde und bei entsprechend engen und bestimmenden Verwandtschaftsverhältnissen identitätsstiftende Bedeutung hatte. Aber diese Bedeutung greift trotz aller Berechtigung zu kurz. Sie bezieht sich nur auf soziale Bande, auf eine schon durch wieder andere Namen (von denen auch einige Eigennamen sein könnten) bezeichnete Handlung. Lacan hat daher zu Recht gesagt, dass der Eigenname eine frei schwebende Funktion hat.(5) Er ist eben durch viele in ihm verwobene Bedeutungen gekennzeichnet, aber auch nur dann, wenn diese Bedeutungen nicht gleich einen zu definitiven Sinn ergeben. Der Eigenname steht der inneren Logik des ‚Namen-des-Vaters‘ nahe.
Levi-Strauss schildert diesen Zusammenhang auch anhand der Beziehungen der Lebenden zu den Toten. Die von ihm auf fast allen Kontinenten untersuchten Primärvölker praktizierten nämlich ein farbiges, reichhaltiges und langwieriges Brauchtum, zahlreiche Zeremonien und Begräbnisriten, bei denen die Toten zu Wort kamen und von bestimmten Gruppen von Männern oder Frauen auch direkt gespielt werden mussten. Doch – so der Autor – nur weil die lebenden Stammesmitglieder ihre Probleme untereinander nicht besser lösen können, weil sie nicht offen und tief miteinander reden, so dass sie sich selber Gegenparts sind, mussten die Toten den Lebenden helfen, musste ein ständiger komplexer Austausch der Lebenden mit den Toten stattfinden. Dazu mussten die Toten in tagelangen Riten und Festveranstaltungen massiv ‚wiederbelebt‘ werden, ein Umstand, den man also doch geschickter mit vertieften und therapeutischen Gesprächen der Lebenden untereinander hätte vermeiden können.
Und noch ein letztes Argument betreffend den Vater-Namen, nämlich das Inzesttabu. Auch dabei handelt es sich um etwas, was nie richtig ausgesprochen wird und dennoch überall wirkungsvoll besteht. Es ist nicht eine Erfindung patrilinearer Kulturen, es kommt vielmehr aus diesem ersten Schritt in die Welt des Symbolischen, Sprachlichen, wie ihn die Psychoanalyse auch mit dem Ödipuskomplex einzukreisen versucht hat. Dort geistert der Vaterspruch herum, der an den Sohn gerichtet „fass die Mutter nicht an“ und an die Mutter gerichtet „friss deine Kleinen nicht auf“ lautete. Kannibalismus und Inzest waren somit ‚Unworte‘, ins Unbewusste verdrängte Power-Namen, die heutzutage in Zivilgesellschaften verständlicherweise zu den gesetzlichen Verboten gehören, anfänglich aber den männlich-väterlichen Herrendiskurs prägten, ohne dass die Herren wussten, was sie sagten. Wir wissen es auch heute noch nicht besser, indem wir zugeben müssen, dass diese Phänomene total abgespalten weiterhin in jedem versteckt weilen, und ich damit den Titel meines Buches – unter anderem – auch so begründen kann: ob Ödipuskomplex oder Herrendiskurs, Schattenbereich jeder Sexualität oder letztliche Identität (speziell Geschlechtsidentität), man muss sein eigener ‚Vater‘ werden.
Man muss im Namen des Vaters reden, denn sonst – so sagen die Psychoanalytiker – kommt gar keine richtige Sprache zustande. Wenn der Junge Nahrung, Pflege und auch noch Sex mit der Mutter haben kann, braucht er ja nichts mehr zu sagen, er bedient sich einfach. Er wird Vater ohne es zu wissen, er wird ein Adonis bleiben, der mit der Mutter-Gemahlin verschmolzen ist. Er wird im Namen des Mannes reden, im Namen des ‚phallus symbolique‘, wo reden nur in ein paar kräftig vorgetragenen Lauten besteht, aber nicht in einer ausgereiften Sprache. Und selbst wenn er sich vom Adonis zum Ödipus entwickelt hat, wird noch zu viel Mann in ihm sein, um die Vatermetapher in ihrer Gänze zu verstehen.
Wegen all dieser Schwierigkeiten sagte Lacan gegen Ende seiner Lehrtätigkeit, wie er früher „in verschiedenen Registern vor allem die Vatermetapher erkundet habe, den Eigennamen. Es gab alles, was es brauchte, um diesem mythischen Elaborat meines Sagens mit der Bibel einen Sinn zu geben. Ich werde das jedoch nie wieder machen, Ich werde das nie wieder machen, denn schließlich kann ich mich damit begnügen, die Dinge auf der Ebene der logischen Struktur zu formulieren, die ja ihre Rechte hat. Voilà!“(6) Die Struktur der Logik, das klingt freilich anspruchsvoller und wissenschaftlicher als der Vater-Name. Ich will darauf zurückkommen, für den Anfang ist der Vater-Begriff jedoch verständlicher.
Damit kann ich auch wieder zum Ausgangspunkt und zu den Regenbogenfamilien der LGBTIQ-Community zurückkommen.(7) Ich habe mir oft vorgestellt, wie es gewesen wäre, wenn ich unter zwei Männern als Eltern aufgewachsen wäre. Ich denke, ich hätte nicht den Vorteil nutzen können, den normierend-normativen Ödipuskomplex zu durchlaufen. Denn wie sollte der mehr weiblich-mütterliche, oft abschätzend als Tunte bezeichnete Schwule, in mir die geheimnisvolle, vielschichtige und glanzvolle Frau vermitteln, indem dieser ja gerade deswegen oft verspottet wird, weil man die künstliche Weiblichkeit an ihm nicht übersehen kann? Aber vielleicht gibt es Ausnahmen, und eine depressive, stark übergewichtige und ständig überforderte Mutter ist dann gar nicht mehr so vielschichtig und geheimnisvoll ? Oder andersherum bei zwei Müttern, bei denen ich doch versucht hätte, den potenten Sexualprotz und gleichzeitig den Überintellektuellen zu spielen. Schließlich, ganz gescheit geworden, hätte ich ihnen vorgeworfen, zu verleugnen, dass der Phallus ein Signifikant ist. Doch dafür hätten sie mich möglicherweise ausgelacht, und die mehr maskuline Lesbe hätte mich mit der Bemerkung vom ewigen Klugschießer aus dem Haus geworfen.
Doch ist dies alles meine persönliche und nicht ausreichend hinterfragte Auffassung. Wie gesagt, zwei taffe, engagierte, lebenserfahrene, -bejahende und erfolgreiche Mütter wären auf jeden Fall besser gewesen, als ein unglückliches, schlecht durch Leben steuerndes Ehepaar alter Couleur. Und so sehe ich im Auftreten der LGBTIQ-Community eine echte Herausforderung unserer Zeit, Gesellschaft, Politik und Psychologie, wozu ich auch mit diesem Buch einen Beitrag leisten möchte. Vielleicht werden auch noch ein paar weitere Buchstaben zu denen der LGBTIQ dazukommen, z. B. SM für Sadomasochisten oder P für Pädophile. Deren Schattenseite wäre allerdings die Realität, die wohl zu Recht strafrechtlich verfolgt wird, aber könnte man ihnen vielleicht mit virtueller Realität helfen?
In dem Theaterstück ‚Die Netzwelt‘ der amerikanischen Dramaturgin Jennifer Haleys geht es um diese teuflischen Kräfte, und weil es Netz-Kräfte sind, passen sie hierher. Das Stück handelt von einem Pädophilen namens Sims, der sich eine Virtual-Reality-Netzwelt – genannt ‚Refugium‘ – erschaffen hat, in der man allen erdenklichen päderastischen Neigungen nachgehen kann. Die dort missbrauchten Mädchen sind also perfekte Computeremulationen, und eine juristische Ermittlerin (Frau Morris) soll nun Sims verhören und feststellen, ob dies so legal ist oder besser verboten gehört.
Sims verteidigt sich damit, dass der Zugang zu dieser Netzwelt streng geregelt ist und auf Freiwilligkeit – und, so könnte man noch ergänzen – auf künstlicher und nicht realer Herstellung beruht, doch die im Theater zwischen Verhörsraum und Missbrauchsraum wechselnde Bühne zeigt die enge Verwobenheit der beiden Netze, des normo-realen und des phantasmatisch-realen. Morris lässt sich durch einen Mann vertreten, der sich in die pädophile Netzwelt aufnehmen lässt, um herauszufinden, was pervers und verboten ist und was nicht.
Doch dieser Mann macht ihr gegenüber wiederum selbst erotische Avancen, so dass sie sich in ihn verliebt und dadurch alles ein bisschen durcheinandergebracht wird. Eine juristische Aufarbeitung erscheint nun nicht mehr ganz relevant, weil sich die Ermittlerin ja nun selbst nicht mehr neutral verhalten kann und von ihrem neuen Lover abhängig ist. Doch die gezeigten Lustmord- und Missbrauchsszenarien tun das ihre. Ist zu viel Pornokonsum nicht vielleicht doch schädlich? Schwelgen nicht Anti-Kriegsfilme immer auch in dramatischen Kriegsszenarien und bewirken so das Gegenteil? Was macht man mit den realen Pädophilen, von denen es offensichtlich mehr gibt, als bekannt ist?
Mit Sicherheit wird es bald derartige Netzwelten geben, perfekte ‚Aktiv-Refugien‘, für die nicht einmal mehr Bilder realer Personen verwendet werden müssen, denn alles ist KI-erzeugt. Doch das Problem ist dann nicht mehr nur das von Herrn Sims, der viele Stunden täglich in seinem ‚Refugium‘ verbringt, aber einem juristischen Verhör noch folgen kann, sondern das, dass jeder Einzelne seine eigenen uferlosen Phantasien virtuell-real umsetzen will und sie alle in der normalen Realwelt nicht mehr zusammenwirken und folgen können. Vielleicht Verändern ein paar Pornofilme nicht den Charakter des Einzelnen, wohl aber eine tägliche Sucht solche Filme zu lange Zeit zu konsumieren.
Der Plot wird jedoch bei der Virtual-Reality-Netzwelt noch weit krasser ausfallen. Möglicherweise hilft den Nutzern (als einer der angekündigten Sonderfälle) dann doch die Psychoanalyse Le Soldats,(8) die wohl noch gerade wissenschaftlich genug ist, um die sexistischen und aggressiven Geister, die in der Therapie wie bei Goethes Zauberlehrling ständig aufgerufen werden, wieder loswerden zu können. Denn ohne eine Schnittstellen-Übertragung in die Welt der kombinierten Wort-Bild-Kommunikation wird man in der Virtual-Reality-Welt vom imaginären Teil der Netzwelt überrollt und verstrickt verloren gehen, egal, ob diese nun pervers oder psychotisch ist, um wieder einmal ein paar Vater-Wörter zu gebrauchen.
[2] Schug, A., et al. Das Regenbogenväterbuch, Ratgeber für schwule Papas, Omnino-Verlag (2020)
[3] Ein Ausdruck des Kognitionswissenschaftlers D. Hofstadter.
[4] Auch dies argumentiert Lacan schlüssig und setzt sich damit von allen anderen Versuchen über gestisches Sprechen, über erste Bezeichnungen für Dinge etc. als Ursprung der Symbolsprache hinweg.
[5] Lacan, J., Seminaire XII, Vortrag vom 6. 1. 65
[6] Lacan, J., Seminaiere Nr. XIX, Ed. Seuil (2011) S. 104
[7] LGBTIQ, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual, Queer.
[8] Ich komme später zu Le Soldats Theorien und ihrer Praxis.