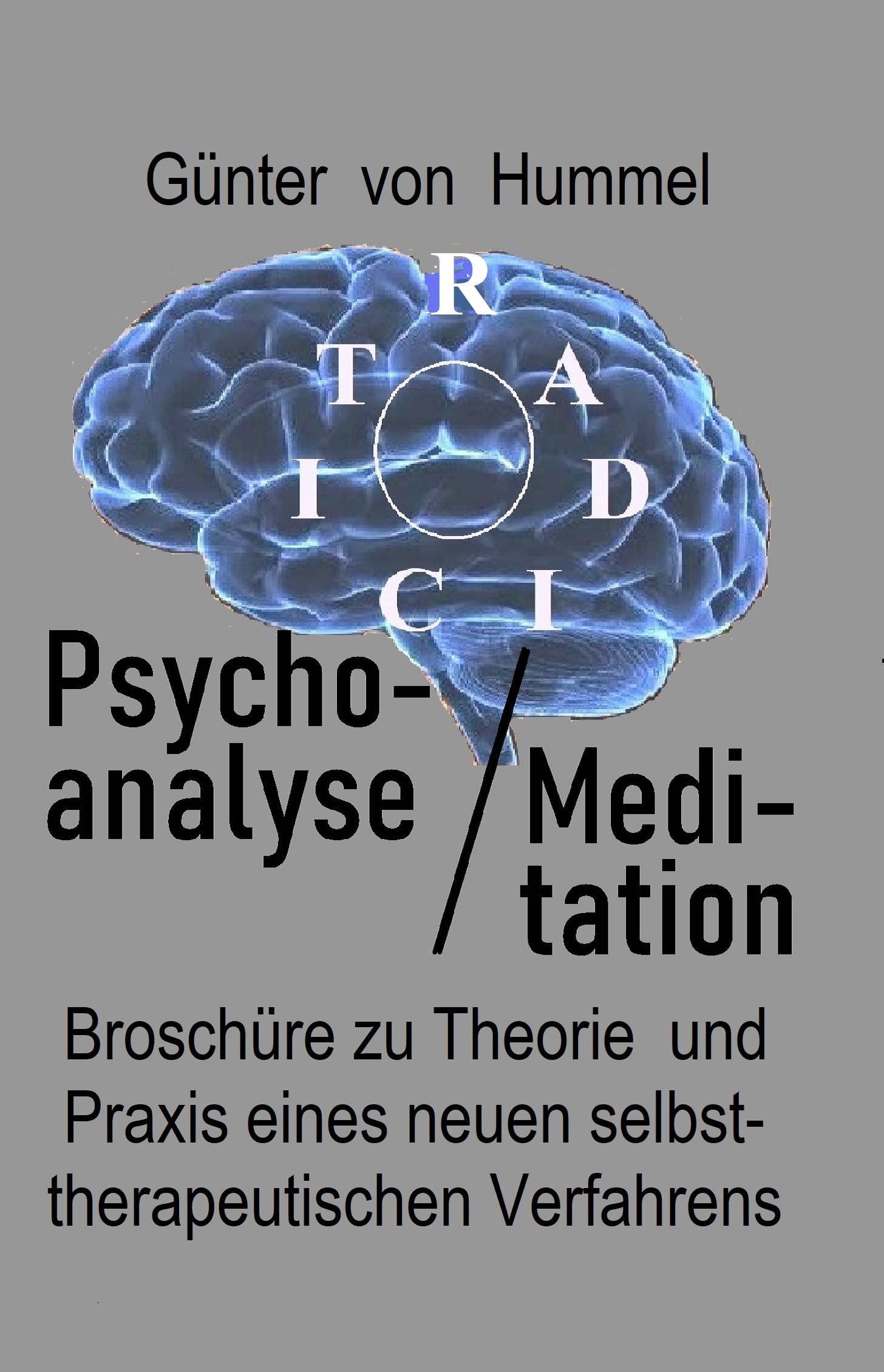Indien ist ein zweigeteiltes Land. Zweigeteilt nicht wegen seiner enormen Differenzen zwischen arm und reich oder seiner ebenso enormen religiösen Spannungen, sondern wegen seiner Psychologie, indisch gesagt: der Vielschichtigkeit seiner Seele. Man findet da auf der einen Seite jene emotionale Oberflächlichkeit, von der manche sagen, es sei Fatalismus (was nur zur Hälfte stimmt), aber auch die Art von Kindlichkeit, wie sie in indischen Filmen zum Ausdruck kommt: dem Bösen sieht man seine Verderbtheit schon an der Visage an, während der Gute ein kitschiger jugendlicher Schönlingsheld ist.
Andererseits aber zeigt sich gerade bei den einfachsten Menschen so oft jenes echte, sanfte und aus tiefster Tiefe kommende indische Lächeln, dieses wortlose Du-zu-Du, das eine Übereinkunft gegenseitiger Freude und Zärtlichkeit, ja einfach einer universalen Gegenseitigkeit ausdrückt. Es handelt sich um ein Lächeln, das aus allen libidinösen Quellen des Körpers zusammenströmt, fast ohne selbst libidinös zu sein, indem es sich auf den Lippen ausbreitet, klanglos, klaglos, im Vorübergehen: Ich bin wie Du, auf der niedrigsten Stufe von etwas sehr sehr Hohem, dem Höchsten.
Denn diese niedrige Stufe von etwas Höchstem nannte Freud das Lust- oder Unlustprinzip. Es hat etwas mit der Lust des Auges zu tun, mit der des Ausgleichs, Gleichmuts, Homöostase : mit der Erotik des unendlichen spekulären Raumes. Die Seele, das Psychische, das Unbewusste, haben beim Menschen eine nie dagewesene Höhe erreicht, aber nichts ist unangenehmer, als wenn diese Höhe zu stark, zu spannungsgeladen, zu lustvoll (oder unlustvoll) ist, weil es voll von Spiegelbildern, von Träumen ist. Während man nämlich so narzisstisch die niedrigste Stufe des Höchsten anpeilend recht aufwendig mit sich beschäftigt ist, kommt man nicht zum wahren Genießen. Auch der Inder kommt dazu nicht, obwohl er eine Richtung gefunden hat, aus der Homöostase wenigstens alltäglichen Nutzen zu ziehen: Die Bewegungen in der Größe der indischen Menschenmengen, die Heftigkeit des alltäglichen Sich-aneinander-Stoßens, der ständige, enge überfrachtete Verkehr finden zwar auf dem niedrigsten Niveau einer extremen Höhe (Menge, Größe) statt und haben auf diese Weise schon die Schönheit einer Kunst, die Perfektion einer Wissenschaft, das Wesen einer Andacht erreicht.
Dazu passt auch, was man in Indien Spiritualität nennt. Denn darunter ist am wenigsten eine nur orthodox, nur operationalisierende religiöse Verfasstheit zu nennen, sondern Spiritualität fängt eben bei jenem milden Lächeln an, das nicht viel Kraft kostet, aber die Reibungen des Alltags so erträglich macht. Das das Gefühl einer Ohnmacht, einer Schwäche aus Kopf und Bauch in den Lippen zusammenströmen lässt und so in einem milden, flüchtigen Sieg verwandelt. Diese Spiritualität schließt gewiss auch jene oft zu naive Gläubigkeit ein, die eine „ozeanische“ Tiefe im Gefühlsleben zu erreichen vermag, eine Beseeltheit, der Freud zu recht große Skepsis entgegenbrachte. Spätestens hier natürlich ( wir Abendländer sagen „natürlich“ statt spirituell) beginnt es sich zu zeigen, daß die westliche Wissenschaft notwendig ist, wenn sie ein Unbewusstes definiert, indem sie sagt, dass es „strukturiert ist wie eine Sprache, w i e die Sprache des Anderen“. W i e, es geht nur um ein Wie, es ist keine wirkliche Sprache.
Denn die „ozeanischen“ Gefühle suggerieren die Eins eines universalen Genießens. Freud ging von einem Genießen aus, einer Lust, die sich in sogenannten Partialobjekten ( z.B. das Oral-Objekt, die Mund-Brust, bei Lacan Objekt „a“ genannt, das STRAHLT) verfängt und verfestigt. Die psychische Energie (Libido) entsteht bei Freud in jenen Randzonen wie etwa dem Mund, mit denen das Subjekt mit seiner Umgebung (z. B. Brust der Mutter) kommuniziert und bildet dabei psychische Objekte aus. Diese Objekte können niemals eine Ganzheit, Einsheit erreichen, in der man sich psychisch vollkommen stabilisieren könnte. Die Eins wird dem Subjekt eher vom Anderen her geboten, vom großen Anderen, Anderen als Unbewusstem selbst, vom Anderen in seiner rein wie sprachlich strukturierten Form, von Lacan einfach „A“ geschrieben, das SPRICHT. Aber auch von diesem „A“ ist die Einsheit nur in dieser Art von sprachlich strukturiertem Zug, der das Subjekt an eine symbolische Ordnung fixiert (identifiziert) und daher auch nur zeitweise stabilisiert, zu erwarten.
Letztlich muss trotz Psychoanalyse das Subjekt sich selbst durchschlagen zu dem Punkt, in dem es sein Sein in befriedigender Weise findet und in seine Lebenslinien auslaufen lassen kann. Diese Linien sind Signifikanten in Bewegung, und ein Psychoanalytikerleben – wo die Psychoanalyse doch inzwischen ein ganz gut angesehener Mittelstandsberuf geworden ist - kommt damit ganz gut aus. Doch was ist mit den Patienten? Die Patienten nicht so in den wissenschaftlichen Fortschritt und die damit verbundene Anerkennung eingebunden, dass ihre Signifikanten in wirklich ausreichende, befriedigende und dauerhaft geordnete Bewegung auslaufen können. Ihre Lebenslinien bekommen zwar einen Halt, eine Besserung, aber keinen Anteil an der Eins jenes Genießens, das das wissenschaftliche Sprechen dem Subjekt bieten kann.
Hier aber könnte uns das indische Konzept weiterhelfen. Der indische Yoga legt seine Schwerpunkte nicht so sehr auf die zonalen Triebe und Randzonenobjekte, von denen wir gerade gesprochen haben, sondern mehr auf jene, die – wie Lacan sagt, mit ihrem Objekt direkt ursächlich verbunden sind: So der Schautrieb mit dem Blick und der Sprechtrieb mit der Stimme. Freud ist davon ausgegangen, dass der „psychische Apparat“ zwar durch eine halluzinatorische Besetzung (Wunscherfüllung) in Gang kommt, also z-B. durch einen äußerst engen Zusammenhang von Schautrieb und Blick. Auch wird von Freud im Begriff des Über-Ichs der gleiche enge Zusammenhang konzipiert, indem er von der „inneren Stimme“ der Über-Ichs spricht. Doch führt Freud diese Konzeption nicht umfassend genug aus. Er behauptet zwar ein dem Lustprinzip gegenüberstehendes Realitätsprinzip, demzufolge das Subjekt lernen muß, seine Blicke der äußeren Realität anzupassen, und wenn man dem die „innere Stimme“ des Über-Ichs als etwas hinzugesellt, das uns für immer der sprachlichen Ordnung verpflichtet, sind wir bei Lacans Kombinatorik von „a“ und „A“, STRAHLT / SPRICHT. Und eben dies gibt es auch im indischen Yoga. Doch wie gesagt muss man dieses Konzept umfassender formulieren.
Im indischen Yoga nennt man das „A“ das Kausale, die Kausalebene. Diesem Kausalen, das der Inder auch ein „Lautprinzip“ nennt (Shabd, Naam, SPRICHT), stellt der Yoga die „Astralebene“ (Sternebene, STRAHLT) gegenüber. In ihr „erscheinen“ die Dinge wie vorstrukturiert – eben wie Sternbilder gezeichnet – und insbesondere „erscheint“ auch hier der Yogalehrer selber in dieser Stern-Zeichnungs-Form, womit der Anschluss an die Realität (des Lehrers) gefunden ist. Während der Psychoanalytiker nur in seiner Übertragungsstruktur im Patienten wieder auftaucht (er „erscheint“ damit nicht wirklich und auch nicht „astral“, sondern ist nur präsent als ein Signifikant in Bewegung), erreicht der Yogaübende hier wirklich die Einsheit, indem die Stern-Zeichnungs-Form des Lehrers nun auch zu „sprechen“ beginnt. Ich setze „sprechen“ in Anführungszeichen, denn ganz vertieft in die Stern-Zeichnungs-Form – so wie man sich in die Sterne eines phantastischen Nachthimmels über der Wüste vertiefen kann – fängt diese Form an sich zu artikulieren, jedoch freilich nur in der Weise, in der wir ihr als Lehrer, Guru, einen Kausal-Zusammenhang unterstellen! Denn diese Einsheit ist auch nur eine von „a“ + „A“, es handelt sich nicht um eine absolut fertiges von sich aus sich ausdrückendes Kausales: einen fertigen, absoluten Gott, von dem man nur nehmen muss, was man braucht.
Selbst wenn der Guru eine sehr hohe ethische, philosophische, yogische, Form auch in seinen Aussagen erreicht hat, so ist seine Sprache doch nicht die eines Psychologen, eines Linguistikers oder eines Psychoanalytikers, der neue Erkenntnisse im Rahmen eines wissenschaftlichen Gerüstes, gar in der Art mathematischer Funktionen formuliert. Doch wenn Lacan unser „a“ (STRAHLT) und „A“ (SPRICHT) in die Formel bringt: 1/a = A / 1+a so entfernt uns die Mathematik gleichzeitig von der Praxis, die sie zu präzisieren hilft. Hier ermöglicht der Yoga eine stärkere Praxisnähe, und wenn es uns gelingt, diese Praxisnähe mit der formelhaften Präzision der Lacanschen Matheme zu verbinden, wären wir ein ganzes Stück weiter. Eben dies wollen wir hier tun, indem wir was die Mathematik angeht, nicht auf die Zahlen ausweichen, sondern bei den Buchstaben, bei der Schrift bleiben, von der die Zahlen ja schließlich ausgegangen sind.
Zuerst haben die Menschen gesprochen, und sie haben nicht in Zahlen, sondern in Signifikanten gezählt. Eben dies bedeutet „Signifikant in Bewegung“. Das Lächeln des Inders ist ein STRAHLT, das auch SPRICHT, auch wenn dies nur eine sehr rudimentäre Form dieser Formel darstellt. Denn zweifellos knüpft es an das Lächeln zwischen Kind und Mutter an, das ein erstes und tiefstes Befriedigungserlebnis hervorruft. „Im Säugen, Umarmen und Anschauen des Kindes empfängt u n d befriedigt die Mutter [und auch das Kind ]zugleich das ursprünglichste aller Begehren“. Es liegt eine Ursprünglichkeit in diesem Lächeln, eine Universalität, Echtheit und Ganzheit, aber sie ist nicht für immer und für alle Lebenslagen geeignet. Es stellt jedoch eine Basis her, ein „a“ + „A“, ein STRAHLT / SPRICHT, und von dem wollen wir ausgehen. Denn es ist ein – zumindest beginnender – Diskurs ohne Worte.
„Die Essenz der psychoanalytischen Theorie ist ein Diskurs ohne Worte“. Es handelt sich um eine derart kompakte Formulierung, die an mathematische Formeln erinnert und an der Grenze der Sprachlichkeit liegt. Aber es ist doch noch w i e eine Sprache. Ein Lächeln, das von den Lippen ausgehend über die Augen die Gesamtheit des menschlichen Wesens ergreift, ist w i e eine unmittelbare, kompakte Sprache. Eine Lippen-Blick- und Augensprache. Eine Yogaübung, ein Mantra, ein Koan oder eine Meditationsformel stellen ebenfalls exakt solche formulierte Strukturen dar. Sie scheinen lediglich nicht wissenschaftlich abgeleitet zu sein und mehr rein glaubensmäßig oder durch die reine Anschauung begründet. Diese verkürzt zwar die oben genannte Formel auf ein 1/a = A, läßt aber außer acht, daß es damit noch kein „Ich des Genießens“ gibt, das genießt und weiß, was das wirklich heißt und wie es geht, das „a“ mit dem „A“ zu kombinieren in einer durchgehenden Schreibung: „aAAaaaAaAAaa“ etc. Es ginge nämlich dabei um eine Schreibung, die das Subjekt selbst üben kann, indem es die Bruch-Formel (Formel mit dem Bruchstrich) linear verwenden kann.
Denn ob Psychoanalyse oder Yoga, was diese Bruch / Formel angeht, sind sie sich beide gleich. Wir können psychoanalytisch in manchen Asanas, Mudras und anderen Konzentrationsübungen problemlos die Freudschen Partialobjekte (etwa das Orale oder Anale) wiedererkennen und umgekehrt können Meditationsübungen, wenn sie als Grundlage eine derartig einfache Bruch / Formel verwenden, zur Lösung psychischer Komplexe beitragen. Dass Indien und der Yoga (oder Meditation) etwas Wesentliches zur psychoanalytischen Wissenschaft beitragen können, zeigt sich schon von der Frage her, warum man nicht vom Blick und vom Auge (und der Blick- und Augensprache) her, von einer „Dialektik des Sehens“ her, die Psychoanalyse erfunden hat. Warum musste es der Unterleib sein, von dem Freud ausging, weil – wie er Napoleon zitierend sagte – „Anatomie Schicksal sei“. Gewiss war etwas Schicksalhaftes hier deutlich zu sehen. Aber dass die Mädchen glauben, zu kurz gekommen zu sein, weil die Klitoris des Mädchens sich wie ein Penis „benimmt“, klingt seltsam. Viel eher liegt ein „Benehmen“ im Blick, der gewiss auch ein Blick auf den Unterleib ist, der Blick-Dialektik ist, in sich verschlungener, verworrener und dann auch wieder strahlender Blick. Lächelnder Blick. Aus jener Tiefe auch des Leibes, zweifellos auch erotischer, wärmender, gegenseitig „erkennender“ Blick. Denn Anatomie ist durchaus auch Schicksal da, wo es um die Wahrnehmung schlechthin geht. Freud zweifelte gewiss keinen Augenblick daran, dass es auch Triebe gibt, die mit der Wahrnehmung zusammenhängen, Wahrnehmungstriebe wie etwa der von ihm selbst so genannte Schautrieb, den er in seinen Werken mehrfach herausstellt. So bestätigt er z.B. ausdrücklich, dass sogar bei den Hysterischen Blindheit durch Verdrängung der Schaulust entsteht. Er erklärt diesen Mechanismus durch Konversion oder Dissoziation unbewusster und bewusster Prozesse.
Er erklärt jedoch an anderer Stelle auch, dass die Verdrängung sich speziell auf die Betrachtung eines „Sexualgliedes“ bezieht, eine wohl ausschließlich auf das männliche Sexualorgan gerichtete Bemerkung. Diese mehr auf die Männlichkeit abgerichtete Wissenschaft ist zwar typisch für Freud, hindert aber nicht, dass die Psychoanalyse dadurch ein klares Theoriegebäude und praktische Erfolge zu verzeichnen hat. Schließlich geht man immer zuerst von begrenzten Vorstellungen aus um dann evtl. auch durch negative Evaluierungen zu allgemeinen Schlussfolgerungen zu kommen. Freud stellt das Sexuelle durchaus nicht nur als befreiend heraus, eher im Gegenteil als problematisch. Wir wollen jedoch hier Theorie und Praxis vereinfachen, indem wir den indischen Blick dem abendländischen wissenschaftlichen Sprechen gegenüberstellen. Und dazu eignet sich eben eine Analyse des Schautriebs und Sprechtriebs, eine Analyse des Seh- und Sprechfeldes am besten. Die Schaulust ist zwar durchaus etwas Libidinöses und auch hier gilt das Homöostaseprinzip und das, was Freud das „Jenseits“ davon nannte, den Wiederholungszwang, den Todestrieb. Doch handelt es sich hier um eher um einen zweiten Trieb, der dem ersten gegenübersteht, und das Tödliche, das Wiederholungsgeschehen hat etwas<damit zu tun, wie diese Triebe kombiniert sind.

Weiterführende Literatur:
Herzsprache. Eine Psychoanalyse des Herzens
Analytische Psychokatharsis: Eine Verbindung von Meditation und Wissenschaft
Ich liebe, also bin ich: Die Geschichte einer Erotomanie und der Versuch einer Dialektik der Liebe