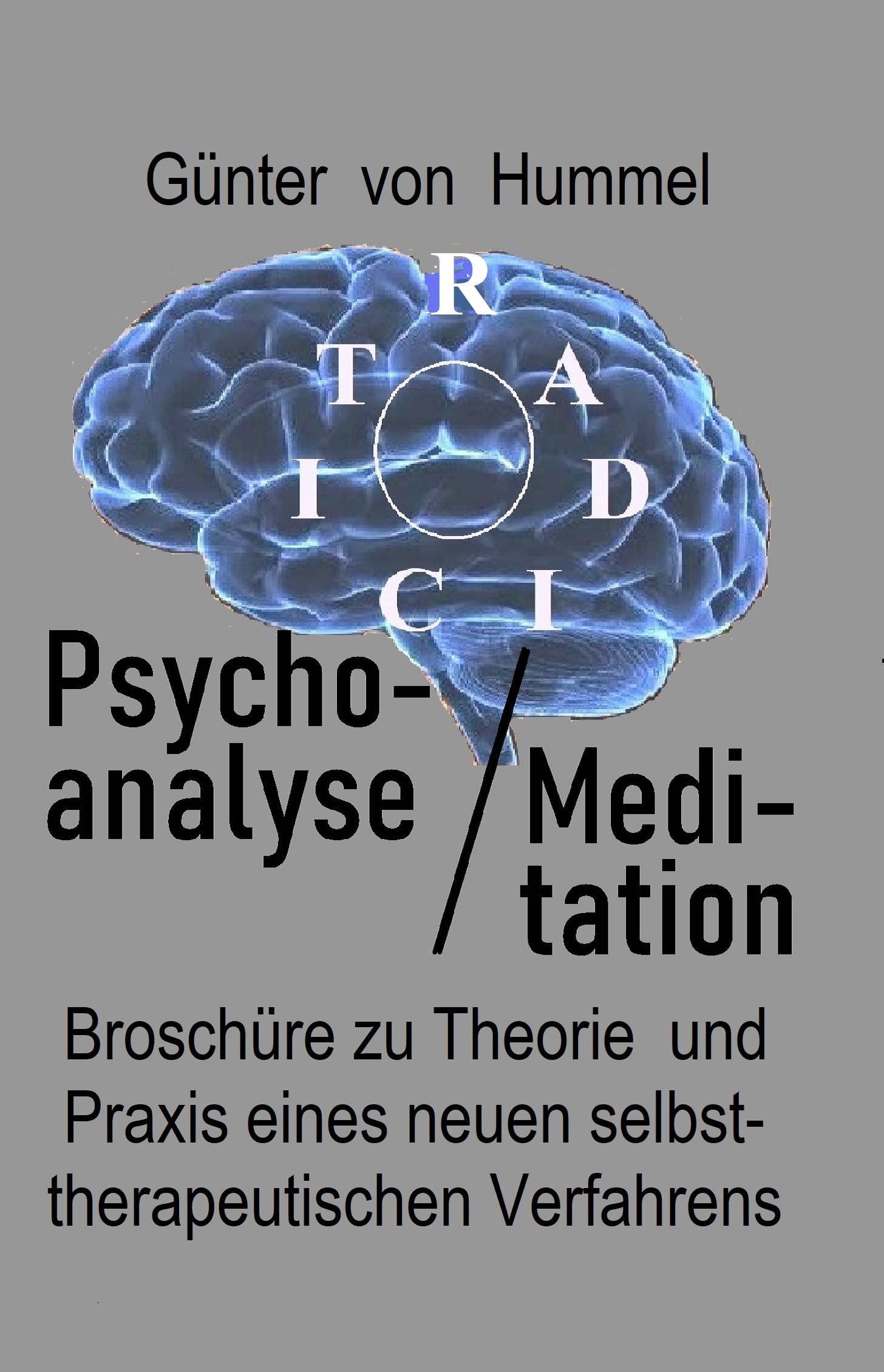Es gibt keine Wissenschaft vom ‚Menschen‘, denn der ‚Mensch‘ der Wissenschaft existiert nicht, es gibt nur sein ‚Subjekt‘, sagte Lacan einmal, also nicht eine Wissenschaft des, sondern v o m Subjekt. Doch auch das Subjekt muss man – will man es zu fassen bekommen – in die Nähe von etwas ‚Objekthaften‘, ‚Objektartigem‘, bringen, so Lacan an anderer Stelle. Man muss es also irgendwie ‚verkörperlichen‘, was meist nur in einer unvollständigen oder primitiven Wissenschaft gelingt . Freilich, für die rein materielle Physis selber benutzen wir eine elaborierte Wissenschaft, aber sie schließt eben den Menschen in seiner Eigentlichkeit, in seinem Subjektsein, in seinem Persönlichen geradezu aus.
Auch die Geisteswissenschaften sind nicht Wissenschaften vom Menschen, denn auch sie erstellen keinen direkten und klaren Bezug zum Subjekt her, insofern es zum Beispiel dem Unbewussten, den unbewussten Kräften, unterstellt ist. Sie versuchen es philosophisch, soziologisch, psychologisch oder sonst wie einzukreisen, aber exakt dahin, wo der Mensch aus seinen Kräften heraus Mensch ist, kommen sie nicht.
Zurück zur primitiven Wissenschaft, bezüglich derer Lacan meinte, dass man sie sich in Form einer „guten Sexualtechnik“ denken müsse. „Eine gute Sexualtechnik ist eine primitive Wissenschaft“, schrieb er im zweiten Band seiner Écrits.[1] Mit anderen Worten: es ist eine Wissenschaft, mit der man – wie gerade oben gesagt – zwar nicht sehr weit kommt, die primitiv bleibt, obwohl sie doch die unmittelbarste Triebkraft nutzt, nämlich die sexuell genannte. Doch ist damit nicht so sehr das Geschlechtsleben gemeint, das die Leute unter Sex verstehen, sondern jede Triebkraft, die eben so direkt nach Befriedigung strebt, dass es den Charakter von etwas Sexuellem, Unwiderstehlichem, fast Impulsivem hat. So kann sich diese Kraft in einem Affekt austoben, kann sich in einer – was eben für den Menschen eine ganz typische Form ist – Sprechlust entladen oder sich in einer inneren Bilderflut, Schaulust fixieren (was Freud eine Triebrepräsentanz nannte). Es findet also eine gewisse ‚Verkörperlichung‘ statt, doch das Wort Technik klingt diesbezüglich wirklich grob, eine Technik des Sexuellen scheint wirklich den Charakter des Primitiven zu vermitteln. Wäre das Wort Praxis nicht besser?
Aber wie ich gerade betonte, kommt man ja auch mit den sogenannt elaborierten Wissenschaften nicht viel weiter. Sie verbleiben jeweils in ihren Bereich eingeschlossen, zeigen darin eine gewisse Exaktheit und Plausibilität, sind aber keinesfalls umfassend. Eben dies ist die "gute Sexualtechnik“ aber auch nicht, obwohl sie doch das Subjekt so unmittelbar verkörperlicht am Wissenschaftsvorgang teilnehmen lässt. Nun hat ja gerade Freud mit seiner psychoanalytisch dargestellten Sexualtheorie eine wissenschaftliche Grundlage dafür geschaffen, doch eben auch hier, fehlt es wiederum an der praktischen Verkörperlichung, denn selbst die psychoanalytische Praxis ist stark beherrscht von Theorie, von Metaphern, Deutungen, distinkten Gefühlen und Affekten. Denn zu viel Gefühl kann es in der psychoanalytischen Sitzung nicht geben, sind doch Gefühle stets nur reziprok und müssen früher oder später auf unbewusste Bedeutungen zurückgeführt werden.
Nur darin, nämlich gefühlsmäßige Ansprüche auf den Trieb im Unbewussten zurückzuführen, besteht die analytische Psychotherapie. Damit gibt sie dem Menschen die Möglichkeit, immer wieder neu auf diese Kraft zurückzugreifen und eine Befriedigung mit einem neuen Ziel zu versuchen bis die letztliche, ideale, gelungene Kombination gefunden ist: die, wenn schon nicht rein sexuelle, so doch „gute Triebpraxis“, das autochthone Genießen, die von Befriedigungen durchwirkte Lebenslust. Und so kommt das Subjekt – eine Wissenschaft nutzend – reell zum Zug. Doch wenn man sich die Ergebnisse der psychoanalytischen Therapien ansieht, hat man nicht den Eindruck, dass es sich wirklich so gelungen verhält.
Die Psychoanalytiker benötigen nämlich dieses oben genannte ‚Objekthafte‘, ‚Objektartige‘, also etwas, das sich im Menschen wie ein Objekt verfestigt hat, um eine präzise Deutungsarbeit zu leisten. Wenn dies aber nicht da ist, nicht erfasst werden kann, wovon ständig in psychoanalytischen Veröffentlichungen der letzten dreißig Jahre gesprochen wird, bleibt nur eine Art von heftiger Empathie übrig, die die Psychoanalytiker ‚Gegenübertragung‘ nennen. Dabei handelt es sich um eine Gegenreaktion auf die ‚Übertragung‘, mit der der Patient in der Therapie Bedeutungen meist inadäquater Art auf seinen Therapeuten ‚überträgt‘ und pprojiziert. In dieser Weise wird der Psychoanalytiker selbst zu etwas ‚Objekthaften‘ und kann versuchen, von dorther Interpretationen zu geben. Dennoch ist klar, geht er in seiner Empathie zu wenig weit, kommt nicht viel heraus, geht er zu weit, wird er selbst zum Patienten.
Dies ist der Grund, warum es die Menschen immer wieder mit der „guten Sexualtechnik“ versucht haben, eine Wissenschaft v o m Subjekt zu betreiben. So hat es schon vor mehr als vier Jahrtausenden bei den Sumerern den ‚Hierosgamos‘ (heilige Hochzeit) gegeben, eine sexuelle Vereinigung des Königs mit der Göttin Inanna, die von einer Priesterin dargestellt und im Tempel vollzogen wurde. Das ganze hatte öffentlichen Charakter, wenn auch stark rituell verbrämt, und wenn der Vollzug „gut“ war, war auch die Regentschaft und das Leben der Gemeinschaft mit guten Vorzeichen gesegnet. Im indischen Khajuraho finden sich noch heute solche Tempel mit zahlreichen Darstellungen sexueller Akte, die die Menschen im Beisein ihrer Tiergötter (z. B. des Elephantengottes Ganesha) vollzogen. Es war auch Tempelprostitution üblich, für die die vielen Pilger, die dorthin kamen, wohl auch zahlen mussten. So bekam die „gute Sexualtechnik“ auch eine materielle Basis, auch wenn man hier erneut das Wort Technik kritisieren muss, denn ein religiöser Zweck stand zweifellos im Vordergrund.
Trotzdem, warum ist hier nicht eine Wissenschaft v o m Subjekt entstanden wie es vielleicht im tantrischen Buddhismus noch eher der Fall war, indem hier der Sexualakt ein Symbol für das autochthone Genießen in der Meditation darstellt. Anstatt ständig nur von göttlicher Ekstase zu reden, wollte man hier die Sinnlichkeit des letztendlich geistigen Aktes betonen. Doch der Spagat, die Diskrepanz zwischen Geist und Sex, zwischen Oben und Unten, ist hier zu krass, zu paradox geraten. Auch die Esoterikmanagerin C. Griscom, eine Mutter von fünf Kindern, beschrieb einmal ein überwältigendes Erleben des Sternenhimmels als „kosmischen Orgasmus". Sie hatte das Gefühl in der Luft zu schweben und meinte sogar aus diesem ekstatischen Sternenerlebnis schließen zu können, dass Gott selbst Orgasmus sei. Genau hier beging sie natürlich den Fehler, Gott ein Geschlechtsverhältnis unterstellen zu müssen. Ist doch gerade der monistische Gott der, der dem Sexuellen meist diametral gegenübersteht. Aber es ist klar, was sie meint: sie hat wieder eine dieser faszinierenden Analogien im Auge, die so beeindrucken, dass man in so einem Moment alles vernünftige Denken über den Haufen wirft. Schließlich vermarktete sie ihr Erlebnis genau in dem Sinne wie es Lacan von der „primitiven Wissenschaft als guter Sexualtechnik“ postulierte.[2]
Nun gibt es hinsichtlich dieser Problematik in der Lacanschen Psychoanalyse dennoch eine trickreiche Lösung. So meint Lacan, dass die Frauen über das „symbolisch-phallische Genießen“ verfügen, d. h. sie genießen den Sex zwar in seiner „phallischen“, aber gleichzeitig ins Symbolische gehobenen Form. Sie ahmen nicht das „Phallische“ der Männer nach, sondern spielen mit ihm in seiner erotischen Mächtig- und Protzigkeit, in seinem erotischen Prahlen, seinem Kraftgehabe, seiner Performance, seiner Potenzialität, seiner großartigen Show und seinem angeblichen Geheimnis. Lacans ‚phallus symbolique‘ hat also nichts mit Sex zu tun, sondern mit den Signifikanten, von denen er einer ist, der kein Signifikat hat, keine Aussage, sondern der nur durch seine Bedeutungs- und Behauptungskunst wirkt. Das weibliche Genießen ist keine „gute Sexualtechnik“, sondern ein sexuelles Versteckspiel, ein erotisches Opus, eine erotische Bildlogik wie ich es oben mit der inneren Bilderflut angedeutet habe. Bei der Frau geht es nicht um eine erotische Technik, sondern um eine erotische Logik, eine Fuzzi-Logik, eine Schaulust. Schon im Hite-Report hatte es geheißen, dass die Frauen bei dem, was man wohl auch nur in seiner männlichen Form Orgasmus nennt, nicht in erster Linie körperliche Empfindungen haben, sondern Licht sehen, blaue Farben und Emotionalit.
Damit schließt sich der Kreis erneut wieder zu einer immer noch nicht ganz perfekten Wissenschaft v o m Subjekt. Wenn man das Verkörperlichende, das ‚Objektartige‘ oder ‚Objekthafte‘ darin einbeziehen will, dann am besten mit einer Praxis, die im ‚phallus symbolique‘ selbst steckt, nämlich seiner Verbindung von Bildlogik mit der Sprachlogik, wobei ich Letztere ja hier in diesem Artikel versucht habe. Aber Bildlogik und Sprachlogik zusammen, egal ob man sie jetzt mit dem Wort sexuell noch verstärkt oder nicht, sind am besten in der Meditation der Analytischen Psychokatharsis zu erreichen, wo laut Lacan ein „linguistischer (Sprachlogisches) Kristall (Bildlogisches)“ in Form sogenannter Formel-Worte verwendet wird. Diese stellen eine Formulierung dar, die in einem einzigen Schriftzug mehrere Bedeutungen enthalten, je nachdem, von wo aus man diesen Schriftzug liest. Hineingezogen in den Sex der B(r)uchstaben (da die Formulierung ja immer wieder von anderen Schnitt- bzw. Bruchstellen verfasst ist), entfaltet sich das autochthone Genießen, das körperhaft (kristallin wie das ‚Durchrieseln‘ bei einem bewegendem Musikstück) ist und gleichzeitig auch seine Logik hat, unbewusste Gedanken, die hörbar werden, eine Kombination also von Sex und Wissenschaft.