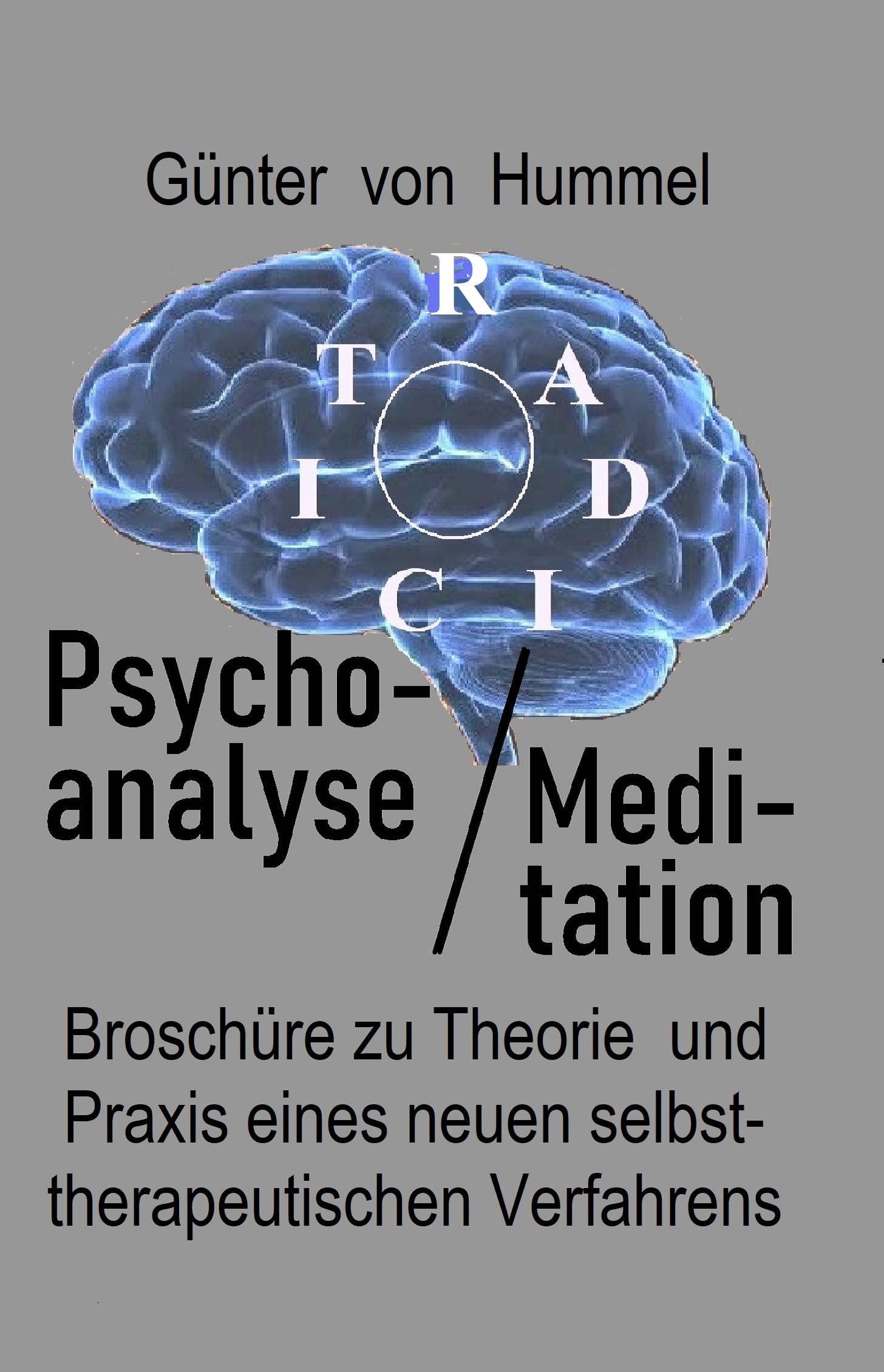Mein Weg zur Analytischen Psychokatharsis
In meiner psychoanalytischen Ausbildung bin ich einen etwas anderen Weg gegangen, als es üblich ist. Bei meinem Antrag zur Aufnahme in das psychoanalytische Institut, musste ich bei drei verschiedenen Lehranalytikern vorsprechen. Einer von ihnen war Professor Elhardt, der mir erklärte, ich könne nie ein richtiger Psychoanalytiker werden, wenn ich vorher eine Allgemeinpraxis eröffne. Ich hatte nämlich zu diesem Zeitpunkt bereits fast sechs Jahre an verschiedenen Kliniken gearbeitet, und war so entschieden, während meiner weiteren Ausbildung zum Lebensunterhalt eine Allgemeinpraxis zu eröffnen. Ich erklärte Professor E lhardt, dass es doch gleichgültig wäre, ob ich noch 2 bis 3 weitere Jahre an einer Klinik verbleibe, oder meinen Lebensunterhalt in einer Allgemeinpraxis verdiene. Ich würde mir vorstellen später einmal vormittags ein paar Stunden Allgemeinmedizin zu betreiben, und dann den Rest des Tages analytische Sitzungen durchzuführen. Aber Professor Elhardt traute mir nicht über den Weg und hielt mich für nicht besonders geeignet die analytische Laufbahn zu ergreifen.
Ich wurde trotzdem zur Ausbildung zugelassen und hatte zudem noch das Glück nicht allzu viel Zeit und Geld investieren zu müssen. Ende der 70er-Jahre wurde entschieden, dass man die Ausbildung noch nach einfachen Regeln beenden könnte, wenn man an dem neu zu schaffenden Titel Psychoanalyse nicht so interessiert sei, sondern mit dem bisherigen Titel Psychotherapie sich zufrieden gäbe. Diesem Angebot folgte ich, was allerdings einschloss, dass ich nicht Mitglied der analytischen Fachgesellschaften werden konnte. Obwohl ich als Psychoanalytiker tätig war und mit den Krankenkassen abrechnen konnte, sollte ich nicht so heißen und auch mich nicht in den fachlich höheren Regionen mit entsprechenden Kollegen austauschen zu können. Mir war dies jedoch ganz recht, weil ich an den gegenseitigen Selbstbestätigungen, an dem Geklüngel eines Fachvereins, gar nicht unbedingt teilnehmen wollte. Mir war lieber, dass ich mich in anderen Bereichen umsehen konnte, viel Literatur anderer Schulrichtungen lesen und mich so ganz eigenwillig orientieren konnte.
Ich hatte mich nämlich schon von Anfang an auch mit Yoga und Meditation be-schäftigt, nachdem ich vor Beginn meiner analytischen Ausbildung einige Zeit in Indien gewesen bin. Mir war zwar klar, dass man die dortigen Verhältnisse nicht auf uns in Europa übertragen kann, aber ich war fasziniert von den Erfolgen einer gewissen Meditationsmethode, die mit bestimmten Sanskritworten arbeitete. Im Grunde genommen war der Erfolg dieser Methode gar nicht zu schwer zu verstehen. Es bestand einerseits eine hochgradige Übertragung der Adepten dieses meditativen Verfahrens auf den Lehrer. Andererseits waren die Sanskritworte selbst für den Inder so fremdartig, dass eine geistige Wiederholung dieser quasi Nonsense-Formeln den gesamten psychischen Organismus auf eine primäre Stufe herunter fahren lassen musste. Diese Methode besorgte sozusagen eine direkte Regressionen bis zu den untersten Stufen zeitlicher und genetischer Art, und ließ eine Progression, also ein positives Weiterentwickeln dann nur dadurch zu, dass man einige profunde Lehrmeinungen des Lehrers pauschal übernahm. Die Lehrmeinungen waren allgemein gültige ethische Regeln einfachster Art. Trotz der Erfolge dieser Methode bei den von mir beobachteten Schülern, war mir klar, dass man dieses Verfahren – wie gesagt - nicht nach Europa direkt übernehmen kann.
Man konnte jedoch etwas anderes tun. Beim Studium der Seminare J. Lacans wurde mir klar, dass im Innersten der symbolischen Ordnung, der Bedeutungs- und Sprachregelungen, etwas korreliert, das dem Freudschen Unbewussten sehr ähnlich ist, um nicht zu sagen ihm völlig entspricht. Ich verweise diesbezüglich gerne auf D. Hofstadters Untersuchungen zum Wesen der Analogien, von denen er die besonders trivialen, einfachen, unmittelbaren Analogien als wissenschaftliche Beweismethode ansah. Egal, Lacan formulierte hier zu den Begriff des „linguistischen Kristalls“, also eines Gebildes, das sprachliche und kristallin gestaltete Aspekte vereint. Genau so, meinte Lacan, ist das Unbewusste aufgebaut. Lacan Betonte die Bedeutung des Kristalls weil seine einfache lineare Form keine Gestalt bevorzugt. Sowohl in der Psychoanalyse wie auch in der Gestaltpsychologie wird die sogenannte gute Form, die ideale Gestalt, präferiert. So glaubt man z. B. Dass das Ich oder das Wissen des Psychoanalytikers besser gestaltet ist, als das des Patienten. Dies stimmt aber nicht, und so liegt der eigentlichen Struktur des Unbewussten, der eigentlichen menschlichen Seele, einerseits ein rein kristalliner Aufbau zugrun-de. Andererseits, und darauf weist das Wort „linguistisch“ hin, steht die Bezogenheit auf das Wort ganz besonders im Vordergrund der psychoanalytischen Therapie.
Dieser Aufbau des „linguistischen Kristalls“ erinnerte mich sehr stark an die oben erwähnten Sanskritworte. Da sie im Grunde genommen nichts mehr bedeuteten, bzw. nichts bedeuten sollten oder der selbst für den Einheimischen fremd gewordene Inhalt dieser Formulierungen nichts Definitives sagte, also nur der reine Buchstaben klang übrigblieb, hatten diese Sanskritworte ebenso keine eigentliche Gestalt. Sie vermittelten aber dem Übenden trotzdem, dass es sich um eine Sprache oder um sprachbezogene Ausdrücke handelte. Der Übende blieb dadurch voll im „linguistischen Kristall“ des Unbewussten. Ja, das Unbewusste wurde dadurch ganz besonders angeregt. Es fand ja eine ständige Wiederholung dieser Formulierungen statt, sodass das Unbewusste gezwungen war, auf diese – im wahrsten Sinne des Wortes Provokation – zu reagieren. Diese Reaktion entspricht genau dem, was man in der klassischen Psychoanalyse den Wiederholungszwang nennt. Das Wiederholungsgeschehen funktioniert hier nur umgekehrt. Während es sich in der herkömmlichen Form der analytischen Therapie hinter zahlreichen Symptomen versteckt, und somit erst mühsam gedeutet werden muss, wird es hier bei der Sanskrit-Wort-Methode sowohl linguistisch wie auch gestaltlos aufgerufen.
Um diese meditative Methode anhand des „linguistischen Kristalls“ für die westliche Wissenschaft brauchbar und verwendbar zu machen, musste ich mir etwas einfallen lassen. Ich kam auf die Idee, Worte der lateinischen Sprache so zu gestalten, dass sie, insbesondere wenn man sie im Kreis schreibt, von verschiedenen Buchstaben aus gelesen verschiedene Bedeutungen ergaben. Damit war erreicht, dass die Formulierung gerade wegen ihrer mehrfachen Bedeutungen keinen einfachen Sinn mehr ergaben. Man musste sich wie bei den Sanskritworten auf den reinen Wortklang beziehen. Gleichzeitig war aber gewiss, dass es sich um ganz normale Sprache handelte. Die Formulierung war wie sonst vom Unbewussten erzeugt aus sich selbst heraus chiffriert und konnte jetzt als Meditationsmethode verwendet werden.
Ich begann jetzt neben der Durchführung herkömmlicher Analysen manchen Patienten zusätzlich die Methode mit den Lateinischen Formulierungen zu empfehlen. Ich bezog mich dabei auf eine Veröffentlichung der Psychoanalytikerin F. Henningsen, die gerade bei traumatisierten Patienten zusätzlich zum analytischen Vorgehen noch andere Methoden empfahl. (Artikel wird fortgesetzt)