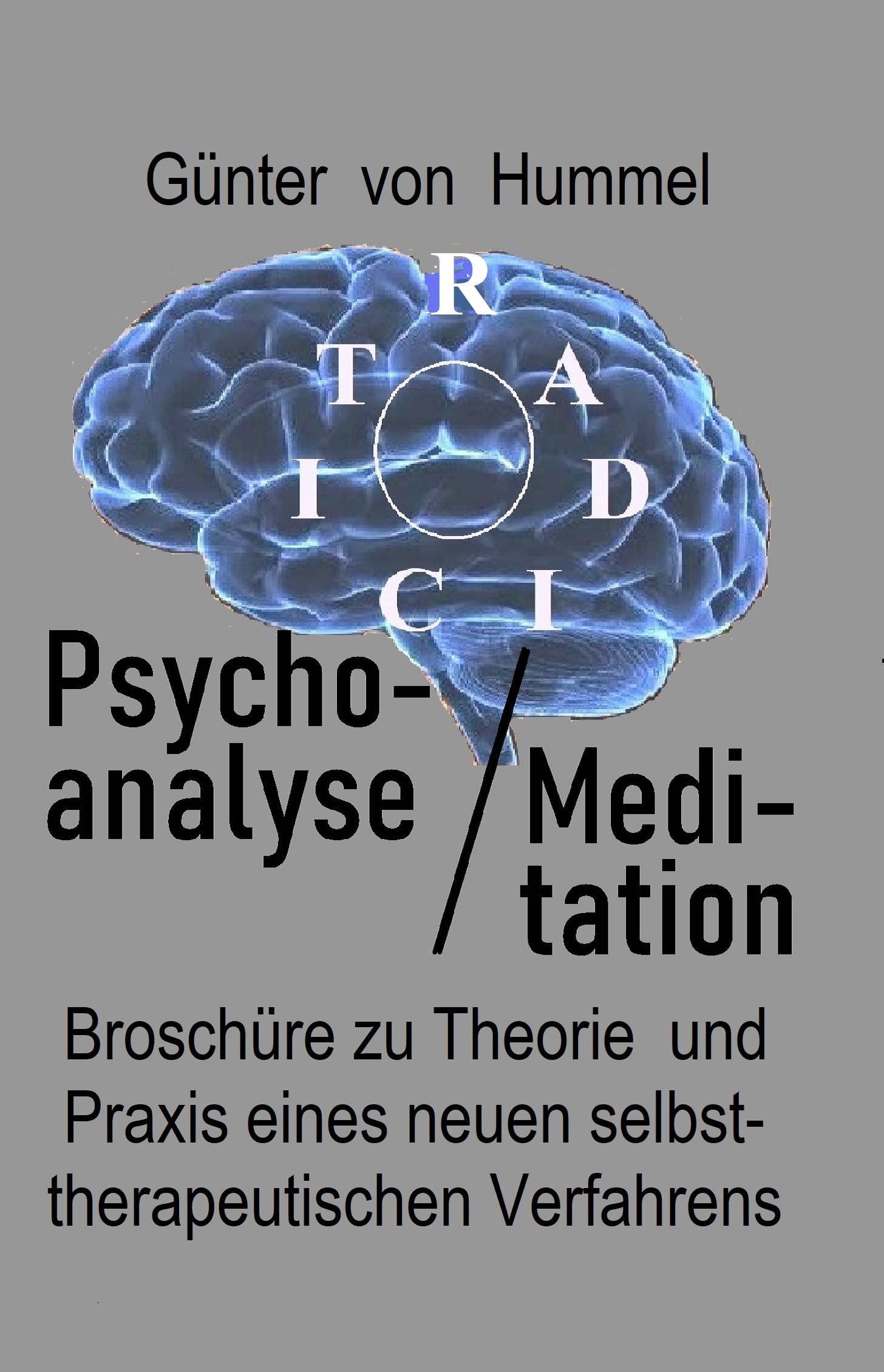Im Gegensatz zu Freuds Psychoanalyse, die den Schwerpunkt auf die Vergangenheit setzte, richtete sich Lacans psychoanalytisches Konzept mehr auf die Zukunft. Wichtig war bei ihm nicht, was man über die Vergangenheit kommunizieren konnte, sondern was sich für eine Zukunfts-Perspektive enthüllen würde. Lacan liebäugelte häufig mit dem 2. Futur, also dem, was einmal geschehen sein wird, und damit hatte er natürlich auch einen Blick weit über den individuellen Tod hinaus. Bekanntlich erlebt niemand seinen eigenen Tod. Andere stellen fest, dass hier jemand gestorben ist und seinen letzten Atemzug getan hat. Aber was ist mit dem Betreffenden selbst passiert? In dem Moment, wo er hätte sagen müssen: jetzt, ja genau jetzt geschieht es, kann er dies ja gar nicht mehr tun. Statt dieses zu sagen oder auch nur dessen wirklich bewusst zu sein träumt er noch seinen letzten Traum. Eine letzte neuropsychische Aktivität ist auf jeden Fall noch da. Natürlich hängt das, was er träumt auch von dem ab, was er im Leben alles erlebt, gedacht und getan hat. Alte Dinge die noch nicht verarbeitet sind können sich genauso in den Traum mischen wie die sogenannten Tagesreste. Aber ist dieser letzte Traum nicht vielleicht doch etwas, das ohnehin immer schon geträumt worden ist?
Das ganze Gerede vom Leben nach dem Tod nimmt dadurch einen ganz anderen Aspekt an. „Was das Jenseits ist“, meint Lacan daher auch, „kann man am besten durch zwei Tode im Diesseits erfahren“. Dabei bezog sich Lacan auf den Marquis de Sade, der der Ansicht war, ein Tod allein genüge nicht. Man müsse den Toten noch völlig zerrmörsern, bis zum Geht-Nicht-Mehr zerreiben und auflösen, weil sonst ja immer noch etwas von seiner alten Form erhalten bleibt und sich so nichts wirklich total erneuern kann. Lacan meinte jedoch, dass man diesen zweiten Tod vor dem ersten, dem eigentlichen Tod, sterben müsste, um den Unterschied zwischen Diesseits und Jenseits nivellieren zu können. Lacan ging davon aus, dass wir in einer perfekten Psychoanalyse so etwas erfahren würden. Der Analytiker macht uns nicht glücklich oder heilt uns in Richtung auf ein allgemeines Wohlwollen. Vielmehr muss er die Behandlung „in der Versagung“ durchführen, mit viel Schweigen und damit, den Patienten sich mit sich selbst konfrontieren zu lassen. „Die Natur des Menschen ist seine Beziehung zum Menschen“, sagt Lacan, und diese Beziehung muss eben in einer regressiven Bewegung brüsk aufgelöst und dann wieder erneuert werden. Ist man auf diese Weise seelisch öfter „gestorben“, geht man gelassen in den Tod, der einem die Möglichkeit zu einem abschließenden Traum, einer endgültigen Enunziation gibt.
Freilich könnte dieser de Sade´sche Gedanke auch an den Freud´schen Todestrieb erinnern, der schon im ganz normalen Leben dazu führt, dass dieses Zermörsern (fachlich: psychische Regression, psycho-somatische Involution) auf einem mehr psychosomatischen Feld schon ständig passiert, obwohl es kein wirklich aktiver Trieb ist. Dennoch ist die Sache einfach zu verstehen. Schon im alltäglichsten Erleben kommt es oft zu Einbrüchen, Depressionen, Schicksalsschlägen, Unfällen und hundert anderen sowohl körperlichen wie auch psychischen Zerkleinerungen, aus denen wir uns meistens nicht mehr zur Gänze erholen. Diese vielen kleinen Tode lassen uns daher ja auch den letzten – und bei de Sade ersten – Tod ertragen. Fast immer spricht man dann von der Erlösung, die der Tod schließlich gebracht hat. Doch kommt dies nicht nur daher, dass man nicht richtig in die Zukunft gelebt, sondern sich immer mit seiner Vergangenheit beschäftigt hat? Man hat das Sein nicht richtig visiert, durchschaut, in den Blick nach vorne hin genommen, und so ist man versehentlich gestorben. Man hat die Mensch-zu-Mensch-Beziehung nicht grundsätzlich erneuert. Man ist nicht nach vorne, sondern nach rückwärts gestorben.
Nach vorne Sterben hieße, dass man die oben genannte Enunziation erreicht hat. Man muss wohl das Zerrmörsern in einer gut ausgeklüngelten, oder gar wissenschaftlich begründeten Form zustande bringen, dann kann man es vielleicht auch gut überleben und so ganz leicht mehrere Tode erfahren und so den letzten (de Sades ersten) Tod siegreich sterben. Um das Sein richtig zu sichten, in die richtige Perspektive zu bringen, kann man nicht einfach nur auf die Einbrüche des Lebens warten. Man muss Körper und Seele in einem Verfahren zusammenbringen, aus dem heraus man sie beide bewusster, konkreter und finalbezogener leben kann. Noch besser als in der klassischen Psychoanalyse, die mehr für das Seelische allein zuständig ist, gelingt dies in der Analytischen Psychokatharsis, die auch das Körperhafte einschließt. Die Katharsis, die ja körperbezogen ist, garantiert, dass der Tod nicht bedrohlich oder gar zerstörend wahrgenommen werden kann. Die Katharsis hat einen Bezug zur Wachheit, zur alertness, auf der einen Seite, idem der Tod ja dem Schlaf nahesteht und bei dem man ja kurz vorher das Bewusstsein verliert. Aber andererseits garantiert die Katharsis auch den engen Bezug zum Worthaften, das die Zukunft anzuvisieren hilft. Man darf sich dies jetzt nicht allzu sehr nur auf den letzten Tod bezogen vorstellen. Es betrifft ja vor allem die vorhergehenden, Involutions- bzw. Regressions-Tode, die durch das Üben der Formel-Worte in der Analytischen Psychokatharsis quasi überspielt, übertönt, übergangen werden.
Während in der üblichen Psychoanalyse hier die Regression eine große Rolle spielt, ist es in der Analytischen Psychokatharsis mehr die Involution. Bei ihr handelt es sich um etwas, das der Evolution entgegengesetzt ist. Natürlich involviert der Übende nicht vom menschlichen komplexen Körper zu simpleren Tierkörpern, also materiell, sondern zu einfacheren Körperbildern, Signifikanten, psychophysischen Zuständen. Diese Reduktion, Involution ist schon aus dem Traum bekannt. Der Träumer selbst ist dort nie ein mit allen Organen und äußeren Erscheinungen, als kompletter Phänotyp sozusagen, vorhanden. Man ist auf etwas Schemenhaftes reduziert, doch gerade dies ermöglicht die Grundtendenzen, Grundstrebungen besser zur Wirkung kommen zu lassen. Man ist dann idealerweise nur noch sich entäußerndes, sprechendes und wahrnehmendes Gebilde wie ich es mit den Begriffen des Strahlt / Spricht vereinfacht ausgedrückt habe. Mit dieser Kombinatorik fängt auch die Mensch-zu-Mensch-Beziehung wieder an und auch die Fähigkeit nach vorne zu Sterben.
In der Involution repräsentiert das Strahlt ein Spricht für ein anderes Strahlt und umgekehrt, so dass man dringend die Formel-Worte braucht, um einen stabilen Fortgang der Übung zu erhalten. Das Ziel ist wie erwähnt ein Pass-Wort, und speziell dieses ist es, das über den Tod hinaus- oder durch ihn hindurchführt und ich dann eine Enunziation nennen kann. So sagt Lacan z. B. auch, dass eine Eins eine Null für eine andere Eins repräsentiert. Im Moment des Sterbens repräsentieren wir als die Eins, um die es ja da ganz entscheidend geht, eine Null (diesen Minimalabstand zwischen Leben und Tod) für . . . ja für was? Eben für das Leben im Tod, doch können wir dies ja nur haben, wenn wir den Null-Eins-Abstand schon für uns realisiert haben, es schon wissen, ja vollkommen in uns integriert haben als die Grundbeziehung von Mensch zu Mensch. Das Leben im Tod gibt es also nur für den, der auch schon davor viele Tode in der Beziehung zu anderen Menschen oder wichtigen Dingen gestorben ist. Wer die Bindung an die frühe Mutter nicht überwunden hat, wer am Lebenspartner klebt, weil er nicht selbstständig ist und viele Beispiele mehr, die zeigen könnten, was es heißt schon im Leben zu sterben und den Tod zu überwinden.
Es gibt bis heute keine empirische Theorie der ersten ganzen Zahlen und so kann für den Mathematiker der Null-Eins-Abstand riesengroß oder winzig klein sein. Die Planck-Zeit – die extrem kürzeste Zeitspanne die es gibt - ist nur eine physikalische Besonderheit. Um eine generelle Aussagen zu machen und um dieser Problematik auszukommen muss man sich also der Henologie bedienen, der Einswissenschaft, in der ein Leben ein Sterben repräsentiert für ein anderes Leben. Es gibt nicht ein Leben nach dem Tod sondern eher ein Sterben im Leben und wenn erst man beides gegeneinander aufwiegt, fängt man richtig an zu zählen. Jetzt ist die Zeit zu zählen, jetzt ist der Herbst da, der den Frühling schon in sich trägt. Jetzt ist die Zeit da, die Menschen zu besuchen, um die Natur der Beziehungen zu begründen. Und wo Zeit ist, ist kein Tod.
Der Tod wäre der Stillstand der Zeit, aber wie kann sie stillstehen, wenn wir noch zählen? Natürlich zählen wir nicht oder nicht nur ein, zwei, drei usw. Wir zählen Hoffnung, Sonnenwind, Lächeln, alle Tage, Zartheit, ein gutes Buch und das Baden der irdschen Brust des Schülers im Morgenrot, wie es im Faust heißt. Wir zählen mit Signifikanten, das sind Lebens-Bedeutungs-Einheiten, glückliche Momente, gelungene Taten durch mörderisches Umwälzen aller Dinge, in denen das Ende aller Zeiten immanent ist. Ja, das Ende überhaupt, so man eines setzen will. Wenn wir als Lebende beteiligt sind in all den Augenblicken eines Sterbens irgendwo und –wann, warum sollten wir dann selbst noch sterben können? Das Leben kann nach dem sogenannten endgültigen Tod nicht in der Weise weitergehen, wie vorher. Es kann nur noch das Raunen der Uhr, der Null – Eins – Null - Eins sein, des universellen Herzpochens, an das wir das Ohr gelegt haben, das weitergeht. Und wenn wir mit diesem Raunen identisch sind, dann können wir zwischen Leben und Tod fast keinen Unterschied mehr sehen. Doch wer ist schon damit identisch?
Das Sterben findet sozusagen ständig statt, sowohl physiologisch wie auch psychisch. Aber es wird auch ständig wieder durch ein Leben ersetzt. Schon im Kindealter sterben Gehirnzellen ab, die später nicht mehr nachkommen und doch wächst der Organismus in ein Leben neu hinein. Diese stets aufs Zukünftige hin gerichtete Einstellung, die nur involutiv Rückgriffe bei der Vergangenheit macht, ist die beste Garantie für ein so intensives Leben, dass es den Tod miteinschließt.