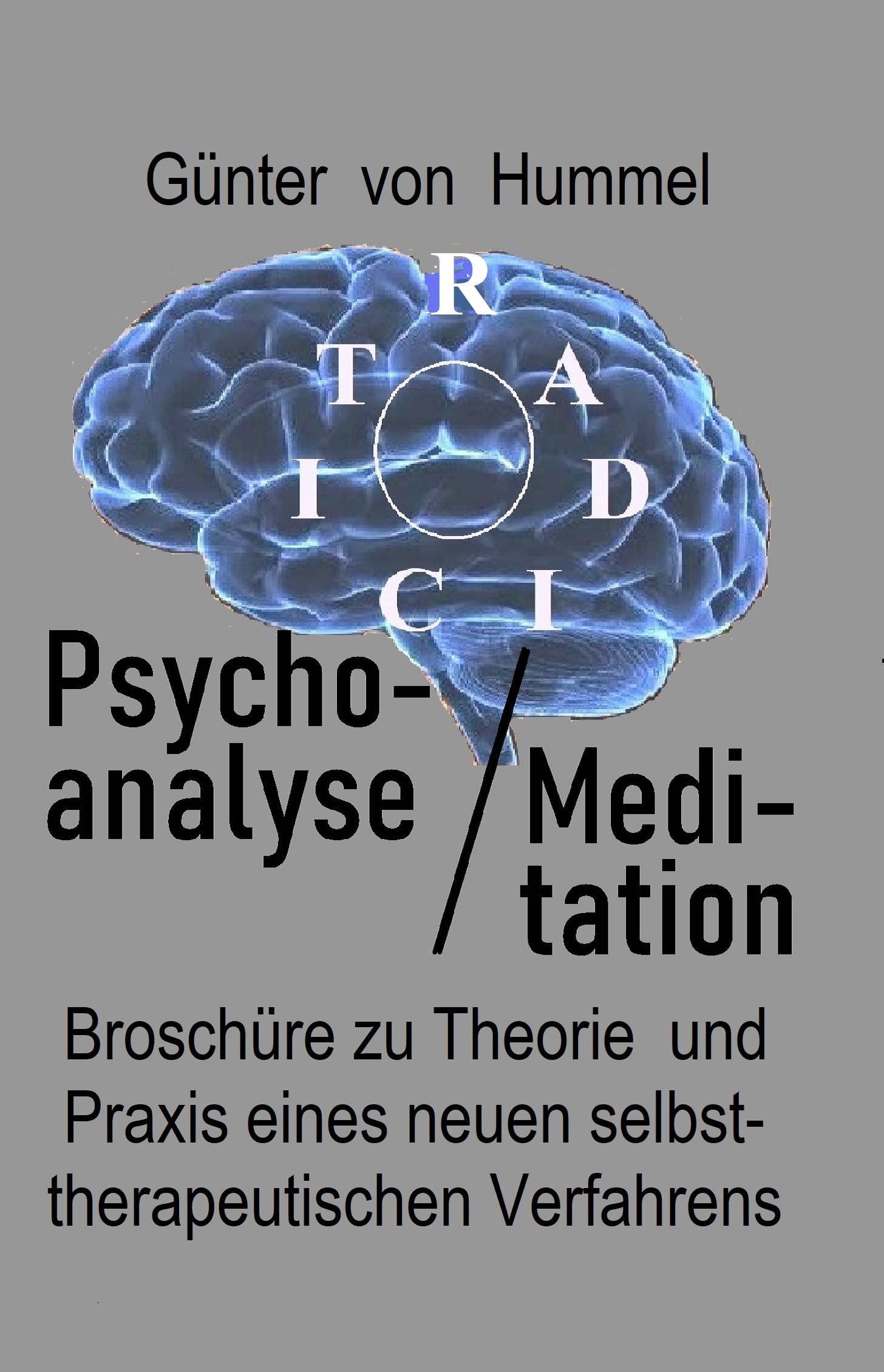In der Psychoanalyse J. Lacans spielt der große Andere (A) eine wesentliche Rolle. Er ist eine innerseelische Instanz, steht ein wenig dem Überich nahe und könnte leicht mit so etwas wie Gott verwechselt werden. Herausgebildet hat sich groß A aus den frühen Bezugspersonen des Kleinkindes, die für dieses ja erst einmal fremdartige Wesen sind, da sie ständig etwas „verlauten“ lassen, was das Kleinkind nicht versteht. Bringt man aber dieses Verlautungssystem, diese „symbolische Ordnung“ in einigermaßen harmonischer Weise dem Kleinkind bei, wird es in sich diese Instanz errichten, die wie ein lebender Anderer in ihm sich – meist jedoch völlig unbewusst – vernehmen lässt. Ganz am Anfang kann dieser vom Symbolischen her stark besetzte Andere kaum mit einem ganzen Satz oder einem Spruch in Verbindung gebracht werden. Es gibt Psychoanalytiker, die behaupten, dass der/das A „mentalesisch“ spräche, also eine Art von direkter Gehirnsprache. Doch macht dies alles nichts klarer. Bei Lacan hat A auch Beziehung zur „Vatermetapher“, also zum Wesen der Paternität, auch manchmal „Name des Vaters“ genannt. Ein Ausflug in die Musik ist hier jedoch erhellender.
Bekanntlich haben die Psychoanalytiker sich nicht nur mit dem Ödipusmythos beschäftigt, sondern auch sehr intensiv mit dem von Narziss, der in extremer Weise in sein Spiegelbild verliebt war. Man hat aus diesem Mythos den Narzissmus abgeleitet, eine besonders starke Form der Eigenliebe. Doch wenn es so etwas auf der Ebene des Bildes, des Spiegels und seiner Oszillationen gibt, warum sollte es dann nicht auch etwas Vergleichbares auf der Ebene der Verlautungen, vom Ton und Klang angefangen bis zum Wort geben? Dazu eignet sich nämlich recht gut der Mythos von Orpheus, dem grandiosen Sänger und Lyraspieler der Antike. Selbstverständlich gibt es auch darüber schon längst psychoanalytische Untersuchungen und Kommentare, in denen die Musik als ‚Gestalt‘ beschrieben wird. Adorno hat dies des Öfteren getan und vom ‚Klangleib‘ gesprochen. Schon an anderer Stelle habe ich Maiello zitiert, eine Analytikerin, die vom „Klangobjekt“ gesprochen hat, das das Kind schon im Mutterleib in sich ausbildet. Maiello geht davon aus, dass das Kind durch die Wahrnehmung erster Klanggeräusche, wie etwa der Stimme der Mutter, ihres Herzschlags etc., durch Laute also, deren Einordnung in das beim Menschen bereits früh ausgeprägte Hör-Sprech-System schon während der Schwangerschaft stattfindet, ein erstes (bzw. hier gleichzeitig zum Spiegelungsvorgang des narzisstisch-autoerotischen nunmehr zweites) seelisches „Objekt“ aufbaut.
Die Psychoanalytikerin D. Birksted-Breen konnte nachweisen, dass in der menschlichen Psyche neben meist unbewusst ablaufenden Spiegelungsprozessen (das erwähnte „ultrasubjektive Ausstrahlen“, die Sichtung, die Neurologen sprechen auch von Spiegel-Neuronen), auch sogenannte "Widerhalleffekte" eine wichtige Rolle spielen. Der "Widerhall" (auch ein Prozess von Gegensätzen, von seelischen und neurologischen Echovorgängen) entsteht zwischen Mutter und Säugling, nämlich zwischen dem Reverie-Geplapper der Mutter und eben dem "widerhallenden" Antworten des Kindes. Es findet also eine erste, akustische Bild-Situation, Signifikanten-Kombination, statt, die noch keine ausgereifte Sprache darstellt, dennoch aber schon symbolische Grundlage hat. Es verlautet etwas, und in diesem Hin und Her der Verlautungen entsteht ein erstes Identitätsgefühl zwischen Mutter und Kind. Ja mehr noch, es entsteht ein Identitätswort, wenn es auch vorerst nur Klänge, Laute und Vokale sind. Das Kind kann sogar meist die rhythmische Lautfolge wiedergeben, also bestätigen, anerkennen. Diese Fähigkeit - ich greife jetzt hier vor und behaupte, dass man auch Widerhall-Neuronen finden wird - von bereits symbolischen Echos ist für das Kind und seine seelische Entwicklung äußerst wichtig. D. Birksted-Breen zeigt Fälle auf, an Hand derer sich ganz klar nachweisen ließ, dass Menschen denen diese Fähigkeit fehlt, nicht träumen können und daher auch meist schwere Schlafstörungen haben.
Auf Grund all dieser und ähnlicher weiterer psychoanalytischer Studien kann man mutmaßen, dass diese Ton-Klang-Verlautungs-Phänomene gut zum Orpheusmythos passen. Denn die Musik – und vor allem auch die, für die Orpheus steht – ist verführerisch. Das kann bis zur Bedrohung gehen. Freud schrieb, dass er unmusikalisch sei. „. . . in der Musik bin ich fast genussunfähig. Eine rationalistische oder vielleicht analytische Anlage sträubt sich in mir dagegen, dass ich ergriffen sein und dabei nicht wissen solle, warum ich es bin und was mich ergreift.“ Freud wollte sich also seine wissenschaftliche Arbeit nicht von irrationalen Genüssen stören lassen. Eine ähnliche Äußerung machte er daher auch R. Rolland gegenüber, als dieser ihm von den „ozeanischen Gefühlen“ schwärmte, die er im indischen Yoga erfahren hatte. Die Musik kann und also in große Höhen führen, aber auch – wortwörtlich – in Hörigkeit. Eine solche spielt ja im Orpheusmythos eine große Rolle.
Orpheus verzauberte mit seinen Melodien nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, Pflanzen und sogar die Steine. Er war also noch äußerst naturverbunden, besaß noch etwas von der ursprünglichen Konnaturalität der ersten Menschen. Dies und auch die Tatsache, dass seine Mutter eine begabte Sängerin war, ließ die Psychoanalytiker immer vermuten, dass Orpheus doch noch einem ziemlichen Mutterkomplex hatte. Darunter ist eine primäre Fixierung an das mütterliche Urbild gemeint, ein orales Verhaftetsein oft verbunden mit dem Wunsch wieder in den Mutterleib zurückkehren zu können, also in die Welt, die Goethe im Faust II als geheimnisvolle, faszinierenden Schauder erregende Unterwelt beschreibt. Deswegen begibt sich Orpheus ja auch in die Unterwelt (Hades), um dort seine verstorbene Frau Eurydike wieder zurück zu holen. Manche Analytiker meinten aber, Kerberos (der schreckliche Hund, der den Hades bewacht) sei eine Vaterfigur und erklären das Zurückholen der Erydike als eine Ödipussituation: Orpheus will sich am Vater vorbei die Mutter als erotisches Liebesobjekt wiederholen. Aber warum hat Orpheus sie überhaupt verloren?
Wie erwähnt liegt es näher, parallel zum Narzissmythos, der sich um das Flimmern der spiegelnden Selbstliebe dreht, den Orpheusmythos als Ton- und Verlautungshörigkeit, als Klangsüchtigkeit und spährenmusikalische Verliebtheit zu beschreiben. Diese Ausdrücke mögen etwas befremdlich klingen, aber Orpheus war wohl schon in die Stimme seiner Mutter verliebt und später in seine eigene Musik. Eurydike war in seinem Leben gar nicht so wichtig wie es scheint. Nichts deutet im Mythos darauf hin, warum Orpheus in sie so vernarrt gewesen sein soll, war er doch vielmehr mit seiner Musik verheiratet. Es sah so aus, als sei sie eher sein Echo gewesen und das konnte er in der Unterwelt nicht hören, weswegen er sich umdrehte, ob sie ihm noch folgen würde. Aber sein Echo kann man nicht sehen und so verschwand sie für immer.
Ich verweise nochmals auf die Untersuchungen von Birksted-Breen und ihre Widerhallgespräche. Es handelt sich um ganz primär-primitive Gespräche, die eine innig-intime Komponente haben. Kleinkinder führen oft abends in ihrem Bettchen halblaute Monologe, die sie sofort abbrechen, wenn jemand ins Zimmer kommt. Schon so früh, weit vor der Entwicklung des Ödipuskomplexes gibt es also diesen wohl auf die Mutter als Intimfreundin abgestimmten Modus einer Klang- und Silbenidentifikation. Orpheus´ Musik ist davon ausgegangen. Eurydike war sein Widerhall und seine Musik bleibt dieser ursentimentalen inbrünstigen Musik verbunden, wie sie die russischen Geiger in Dostojewskis Erzählungen manchmal vorführen.
Dass Orpheus Musik auch unglaubliche Höhen erreicht hat, ist dazu kein Widerspruch. Die Kastratenstimmen der Barockopern lösen auch heute noch Verzückungen aus (oft mehr bei Frauen als bei Männern), was man ähnlich erklären kann. Der Kastrat kann den reinen, noch an die Kindheit angelehnten und nachinspirierten Ton singen, der außerhalb der sonst kulturell und musikgesetzlichen Klang- und Harmonieformen liegt. S. Leikert beschreibt diese beiden auseinanderliegenden musikalischen Wesenszüge anhand der Psychoanalyse Lacans. Es geht in dieser Abhandlung um die Frage, ob Musik auch symbolische Wirkungen erzielen kann, oder ob sie nur – aber was heißt hier nur – im Imaginär-Realen, also in einet tatsäch-lich verführerischen Welt funktioniert. Leikert beruft sich auf Nietzsche, der ebenfalls „die monadische Topologie des ‚Ur-Einen‘ und seiner Repräsentanz in der Musik“ dem gegenüberstellt, was den Übergang zu einer vorstellbaren Welt, die also nicht mehr so monadisch ist, ausmacht. Was Freuds musikalische Aversion also beinhaltet, ist vielleicht nicht nur das Irrationale, sondern auch die Angst vor einer Verschmelzung mit A (A hier als primär-einfaches Anderes wie es die Mutter war). Denn der Lacansche A bietet die Möglichkeit mit ihm zu sprechen (deswegen steht er der Vatermetapher näher). Man könnte verkürzt wieder sagen: es geht darum, ob Musik „mentalesisch“ sprechen kann, ja vielleicht sogar fast wortklanghaft. Wäre Letzteres nämlich der Fall, würde selbst Freud eine derartige Musik genossen haben, weil er dann nicht nur ihre melodische Form, sondern auch ihre wenigstens rationalnahe Aussage verstanden hätte.
Bekanntlich gibt es immer ein großes Problem mit dem Musik-Verstehen. Dieses Verständnis hat nämlich Ähnlichkeit mit dem Mathematik-Verstehen. Denn bezüglich Orpheus glaube ich, dass er seine Musik gar nicht verstanden hat. Er hat sie spielen können und andere verzaubert, aber wie Freud hat er eigentlich nicht gewusst warum und wie das alles geschieht. Dabei geht es natürlich nicht um die „äußere“ Bedeutung von Musik, die zu verstehen wäre, also etwa eine Abhandlung über die chinesische Oper zu lesen und zu verstehen. Es geht wie R. Jourdain sagt, um die „innere Bedeutung von Musik, der Bedeutung, die lediglich in den Klängen liegt.“ Eine solche gibt die Musik selbst nicht her, wie der Autor weiter betont. Überhaupt existieren unzählige Versuche Musik und Sprache zu vergleichen und auf einen Nenner zu bringen. Jourdain erwähnt z. B. das ‚Phrasieren‘, das hauptsächlich dann erfahrbar wird, wenn Musik durch eine Stim-me vorgetragen wird, auch wenn keine klaren Sätze in diesem Singsang vorkommen. Dennoch wird wirkliche Bedeutung erst übertragen, wenn die ‚Phrasierung‘ auch grammatikalisch, syntaktisch einigermaßen stimmt und also auch Sprache ist.
Jourdain kann nur zwei Dinge feststellen. Erstens, dass Musik tatsächlich das Gehirn beruhigen und harmonisieren kann. Zweitens, dass sie eine „Sprache der Emotionen“ vermittelt. Doch was heißt das alles? Dass das Gehirn harmonisiert werden kann mag für einige Parkinsonkranke – der Autor erwähnt dieses Beispiel – von Vorteil sein. Sie bewegen sich im Rhythmus der Musik besser. Aber geheilt werden sie dadurch natürlich nicht. Zudem: wir sind nicht unser Gehirn. Und was sind Emotionen? Auch hier muss Jourdain wieder das Gehirn als Stütze zu Hilfe nehmen. Musik kann dem „Gehirn hochgeordnete Erfahrungen vermitteln“, ja „Transzendenz nahebringen“. Aber Emotionen, Gefühle, wie wir sie im Alltag haben, und die ja immer auch mit situativen Bedeutungen versehen sind, kann Musik natürlich nicht vermitteln. Musik kann uns nicht lehren, wie man Eifersucht los wird oder Erotik gerade mit einem bestimmten Partner erleben kann. Musik wühlt Emotionen auf, irgendwelche, die vielleicht gar nicht zu dem passen, was man gerade fühlen möchte. Und wenn es sich doch so verhält, man z. B. traurig ist und sich dazu eine entsprechende tieftönende Musik in den CD-Spieler legt, kann man diese Stimmung natürlich noch vertiefen. Aber ist das sinnvoll?
Musik vermittelt also extremste Gefühle, aber eine Sprache ist dies nicht. Jourdain meint, Sprache könne niemals das Strömungsmuster eines dahinrauschenden Flusses wiedergeben. Aber gibt Musik wirklich das Muster wieder? Man sollte den Endmonolog der Anna Livia Plurabelle in J. Joyces Finnegans Wake lesen, um den Fluss rauschen zu hören. Man könnte auch nur ein Wortklangspiel bieten: glucks-gurgl-schsch-rauchschgurgl gleitet das Wasser dahin schaumsprudelnd strömend. Natürlich kann Musik noch mehr, aber weiß man dann ob es ein Wasserfall ist oder ein Fluss? Ich habe dieses Wort-Silben-Spiel dennoch gebracht, weil es hinführt zu dem, um was es mir grundsätzlich geht. Um das Verfahren der Analytischen Psychokatharsis bzw. die Wissenschaft von ENS-CIS-NOM. Hinter diesen Buchstaben verstecken sich nämlich ähnliche Zwecke wie hinter der Musik. Nur geht es hier eben darum, ebenso wie die Musik an den Rand des Sprachlichen zu kommen, jedoch mit den Mitteln des so verfassten Unbewussten. Das Unbewusste spricht nicht „mentalesisch“, aber es ist auch keine Musik, es redet direkt. „Es grummelt, „röchelt, schreit, gurrt ..; es kennt alle Kategorien des Vokalischen. Es ist ein sexueller Aspirationslaut, schreibt Lacan.“ Und der hat etwas mit der Wahrheit zu tun. Dahin kann Musik auf keinen Fall kommen. Mit der Wahrheit hat sie´s nicht. Und so hat sie´s auch mit A nur in rudimentärer Form.
Zu A und zur Wahrheit kann man mit ENS-CIS-NOM eher kommen. Denn übt, meditiert, wiederholt man rein gedanklich diese Formulierung, wird man das Unbewusste zu einer eigenen Aussage anregen. Ich gehe hier jetzt nicht genauer auf diese wissenschaftlich und psycho-linguistisch begründete Methode ein, diese ist leicht z. B. unter „Die körperlich kranke Seele I“ nachzulesen. Ich möchte hier nochmals auf die Mathematik und groß A zurückkommen. Lacan meinte einmal, A zu lieben käme auf so etwas heraus wie es das Wesen der Nachbarzahl vermittelt. Es hat etwas mit der Nächsten- bzw. Nachbarnliebe zu tun. Es ist etwas Zwiespältiges, dennoch ist Liebe im Spiel. In der Psychoanalyse muss man A nicht unbedingt lieben, A wird ja durch den Analytiker vertreten und repräsentiert. Wenn der Analytiker sich jedoch im Laufe der Therapie aus dem Spiel herauszieht (d. h. die sogenannte Übertragung analysiert), wird man ein anfangen A ein bisschen zu lieben, denn er/es bleibt ja trotzdem bestehen. A bleibt als „Schatzhaus der Signifikanten“ weiter der/das Andere in uns. Und der/das A spricht weiter, zwar nicht „mentalesisch“, auch nicht musikalisch, aber doch mathematisch. Eben mit Nachbarzahlen.
Nachbarzahlen heben in der Mathematik keine große Bedeutung. Aber sie geben der Hauptzahl eine solche ab, sie umkreisen sie. A ist wichtig, aber noch wichtiger ist das Subjekt selbst. Musik kann das Subjekt nicht zu seiner ihm zugehörigen Wahrheit führen. Sie kann es verzaubern, betören, die Stimmungen erfahren lassen, die der Komponist auch tatsächlich intoniert hat. Aber was sind Stimmungen, wenn sie ohne die Stimme des Geliebten sind, von dem ich hier in diesem Artikel behaupten will, dass er in A zu finden sei. In A und nur da. Da muss man über Orpheus hinauswachsen und auch über die Mathematik. Denn so prägnant sie ist, sie ist auch lebensfern. Wenn Lacan die Liebe zu A mit den Nachbarzahlen in Verbindung bringt, so natürlich deswegen, weil man weiter gehen muss: von der Leibe zu A zur Wissenschaft. Früher ging man zum Glauben, zur Mystik, zur Selbstekstase als Religion. Heute muss man zur Wissenschaft kommen, zu einer Wissenschaft v o m Subjekt, zu einer der Liebe unterstellten Wissenschaft.