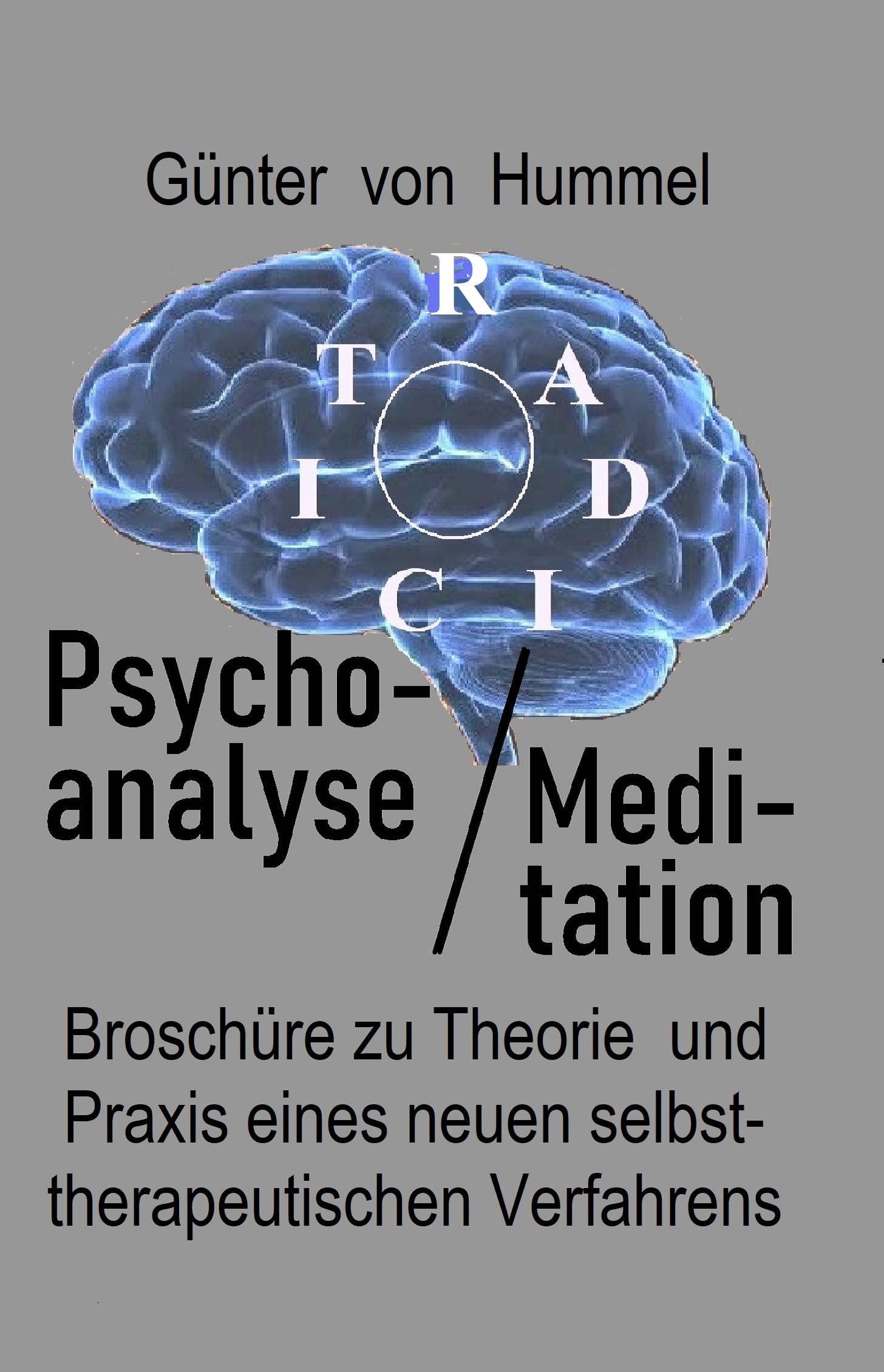In der Psychoanalyse spricht man von projektiver und introjektiver Identität. Bei der ersteren identifiziert man sich mit etwas, das durch eine Projektion entsteht. In das Sturm-Gewitter projiziert man einen Gott hinein, der die Menschen für ihre Sünden strafen will. Man kann den Anblick und das Erleben von Blitz und Donner jedoch auch so verinnerlichen (introjizieren), dass es zu einem inneren Objekt der Angst-Lust wird wie man es auch beim Fahren in einer Achterbahn tut. Die Angst-Lust knüpft an frühere Begebenheiten an, etwa an Erfahrungen mit dem ganz frühen mütterlichen Objekt, das noch nicht dauerhaft positiv besetzt ist. All diese Identitäten hängen stark mit der primären Wahrnehmung zusammen, die noch nicht oder nur kaum durch Symbole, also bedeutungstragende Elemente mitgesteuert wird. Wenn die Mutter im frühesten Kindesalter auch nur „good enough“ ist wie es der englische Psychoanalytiker D. Winnicott ausdrückte, wird der heranwachsende Mensch ein positives inneres Objekt, ein konstantes Ich ausbilden, das seine hauptsächliche Identität ist. Projektive und introjektive Elemente sind dann darin noch in geringem Maße enthalten.
Doch das Ich ist ein vorwiegend vom Imaginären her bestimmtes inneres Objekt. Bild um Bild hat sich aufeinandergeschichtet und sich verdichtet und so ein doch relativ festes Kennzeichen gebildet, einen imaginären Signifikanten, der jeden Morgen wieder als gleicher aus dem Traum erwacht, obwohl er sich nachts total zerlegt hat. Das Gleichgewicht des primären Ichs ist also ziemlich labil, und deswegen geht ja auch mancher zum Psychoanalytiker, um sich behandeln zu lassen. In der psychoanalytischen Behandlung muss das Ich dann irgendetwas erzählen, phantasieren, preisgeben und enthüllen. Es setzt damit dem imaginären Signifikanten den verbalen Signifikanten entgegen. So entsteht ein besseres Gleichgewicht. Das Ich ist jetzt nicht nur Ich, das sich zeigen kann, es kann jetzt auch noch sein Wort machen und in der Gesellschaft besser bestehen. Es wird ein gutes inneres Objekt sein.
Auch Psychoanalytiker machen sich Gedanken Identität. In dem Buch „Die leere Couch“ (Junkers, G., Psychosozial-Verlag, 2013) diskutieren sie darüber vor allem vor dem Hintergrund, wenn die psychoanalytische Couch oder der Sessel leer bleibt (aus Altersgründen, Patientenmangel etc.). Wer sind wir eigentlich, wenn wir nicht voll in Arbeit und Erfolg stehen, fragen sie sich. Und die meisten diskutieren dabei ihre Zugehörigkeit zur psychoanalytischen Community, zur Gruppe der Kollegen und Kolleginnen. Wenn sie da nicht mehr so richtig dazugehören, wer sind sie dann noch? Es ist schon erstaunlich, dass sie sich solche Fragen überhaupt stellen. Denn natürlich haben sie durch ihre Ausbildung und Arbeit ein recht gutes inneres Objekt aufgebaut, das stabil und positiv ist. Die Couch ist außen leer, aber innen führt sich alles voll und gut an. Aber es bleibt nicht so und genügt so auch nicht ganz. Die Community fehlt.
Schon Freud hatte dagegen argumentiert und nicht zugelassen, dass man sich die Frage so stellt. In seiner Schrift „Das Unbehagen in der Kultur“ zeigt er auf, dass der Schutz der Gruppe, der Nation, des Volkes oder jeder größeren Gemeinschaft durch zu viel Kultürlichkeit, zu viel überdeckenden Arrangements, zu viel Wir-Gefühl gar nicht gut ist. Er wollte nicht, dass seine Schüler eine solche psychoanalytische Community bilden. Sie sollten vielmehr so wie er eigene, erfinderische, kreative Wege gehen und Pioniere der weiter entwickelten Psychoanalyse werden. Das wissen auch die heutigen Psychoanalytiker sehr wohl, auch wenn sie darüber diskutieren. Dennoch sehen sie keinen Ausweg und hängen an ihrer Gruppe. Meines Erachtens ist J. Lacan daher der einzige Psychoanalytiker, der aus diesem Gruppenzwang ausgebrochen ist und einen Neubeginn auf den Freud´schen Spuren gewagt und auch mit Erfolg weitergeführt hat.
Aus seinen Konzept der zwei Grund-Signifikanten S1 und S2, die ich hier mit dem verbalen und imaginären Signifikanten, Kennzeichen, Grund-Trieben oder Prinzipien gleich gesetzt habe, konnte ich ein Verfahren entwickeln, mit dem die eigene Identität vertiefter, bewusster und verbindlicher erreicht werden kann (Analytische Psychokatharsis). Denn das Ich genügt – wie gesagt – nicht. Und auch der berufliche oder familiäre Werdegang reicht meist nicht aus, sich seiner nicht nur gesellschaftliche Belange umfassenden Identität sicher zu sein. Früher haben die Menschen noch stärker als heute ihre Identität aus der Arbeit bezogen und wurden auch so benannt: Müller, Bauer, Schmid etc. Heute sagen in den meisten Fällen die Namen, in denen man sich anerkennen konnte, hinsichtlich dieser Identität nichts mehr aus. Wir wollen uns auch im weitesten Sinne anerkannt und bestätigt wissen, auch von innen, vom Unbewussten her. In den siebziger Jahren, als Bhagwan Shree Rajneesh tausende Menschen in Poona und anderswo um sich scharte, bekamen seine Schüler indische Namen, wie sie im Yoga und Hinduismus üblich waren. Sie sollten die neue Identität der Schüler ausdrücken, die jetzt eben durch eine Initiation in den meditativen Bereich als völlig neu und vertieft angesehen wurde.
Man war nicht mehr einfach nur Herr Müller, Bauer oder Schmid, auch nicht der Bankangestellte, Koch, Arzt oder Abteilungsleiter, auch nicht der Ehemann und der Vater der Kinder, sondern Ananda, Bhakti oder Mapreya. Freilich war dies weitgehendst unsinnig, denn man hatte sich nur eine andere Kultur und Methode übergestülpt. Was wir brauchen ist eine Identität im modernen Sinne und in der gelungenen Kombination von S1 und S2. Wir müssen mit Bildern von Worten und mit Namen von Vorstellungen, Illustrationen oder Erscheinungen in uns eindringen, durch Projektion und Introjektion zugleich, um das gute innere Objekt entstehen zu lassen, auf das wir uns als umfassender Identität immer stützen können. Es ist schwer zu sagen, wie man dieses reiche und fast möchte man sagen ideale innere Objekt beschreiben könnte. Denn es ist ja das Innere eines jeden Einzelnen, nicht für alle gleich zu charakterisieren. In seinem Buch „Dem Ungeist widerstehen: Hitlerjunge - Straflagerhäftling – Jesuit“ (echter-verlag, 20139 beschreibt der Autor A. Klein wie er als Sechzehnjähriger durch Verwechslung für einen SS-Angehörigen gehalten wurde und vor der Erschießung durch die Ameri-kaner stand. Beim Klicken der Entsicherung des auf ihn gerichteten Gewehrs wurde er völlig gleichgültig, ruhig und wie in sich durch eine Art von Apathie fest, steif, verhärtet. Man hat ihn nicht erschossen und dieses Gefühl innerer Festigkeit und Stärke hat ihn nie mehr verlassen. Das ideale innere Objekt kann auch vom Tod nicht bedroht werden.
Doch auch das ideale ist kein absolutes Objekt. Dieses gibt es selbst für die Physiker heutzutage nicht mehr, seitdem sie annehmen, alles löst sich letztlich in sogenannten Strings, ultrahauchdünnen Fäden auf, die nicht mehr objektiv, sondern nur noch mathematisch zu fassen sind. Für den Psychoanalytiker existiert solch ein Objekt schon gar nicht, steht für ihn ja das Subjekt im Zentrum. Nun kann man das der Sprache, der unbewussten symbolischen Ordnung unterstellte Subjekt wieder gut dem S1, dem verbalen Signifikanten zuordnen und das Objekt als solches eben dem S2, dem imaginären Signifikanten. Deswegen ist neben dem psychoanalytischen Redenlassen auch das meditative, kontemplative Seinlassen, Schauenlassen, Sichvisualisierenlassen genau so wichtig. In der Analytischen Psychokatharsis wird beides vereint und zwar auf eine Weise, die der damit Übende selbst erarbeiten kann. Nichts, was hier gesagt wurde, muss er akzeptieren, er muss nur die Übungen ausprobieren. Denn das Reale kann man so nicht sagen.
Das Reale ist nicht die Realität, die äußere Wirklichkeit, sondern des wirkend Wirkliche, das, was laut Lacan auch das Unmögliche ist. Jeder stößt nämlich immer wieder an seine Grenzen, mag er noch so weit entwickelt und gebildet sein. Und wenn es viele solche Jedermanns sind, die an die Grenzen stoßen und sie daher das Gefühl haben, dass es die gleiche Grenze für alle ist, wird auch sichtbar, warum dies real genannt werden muss. Man kann die Grenze weiter und weiter schieben, vielleicht noch ein Stückchen nach vorne, aber letztlich ist „das Reale ohne Riss, ohne Kluft“ so wie die Strings, die einfach nur das sind, was sie sind: ultrahauchdü . . . . sinnlos weiter zu reden. Mit jedem Reden nämlich „machen wir ein Loch ins Reale“, schreibt Lacan weiter und mehrfach in seinen Seminaren. Man muss dieses Lücke, dieses Loch also so klein lassen wie es geht. Und das geht am besten mit Formulie-rungen, die so klein sind, dass man sie kaum noch als Sprache fassen kann (siehe Ausführungen über die Formel- und Passworte auf der Webseite).