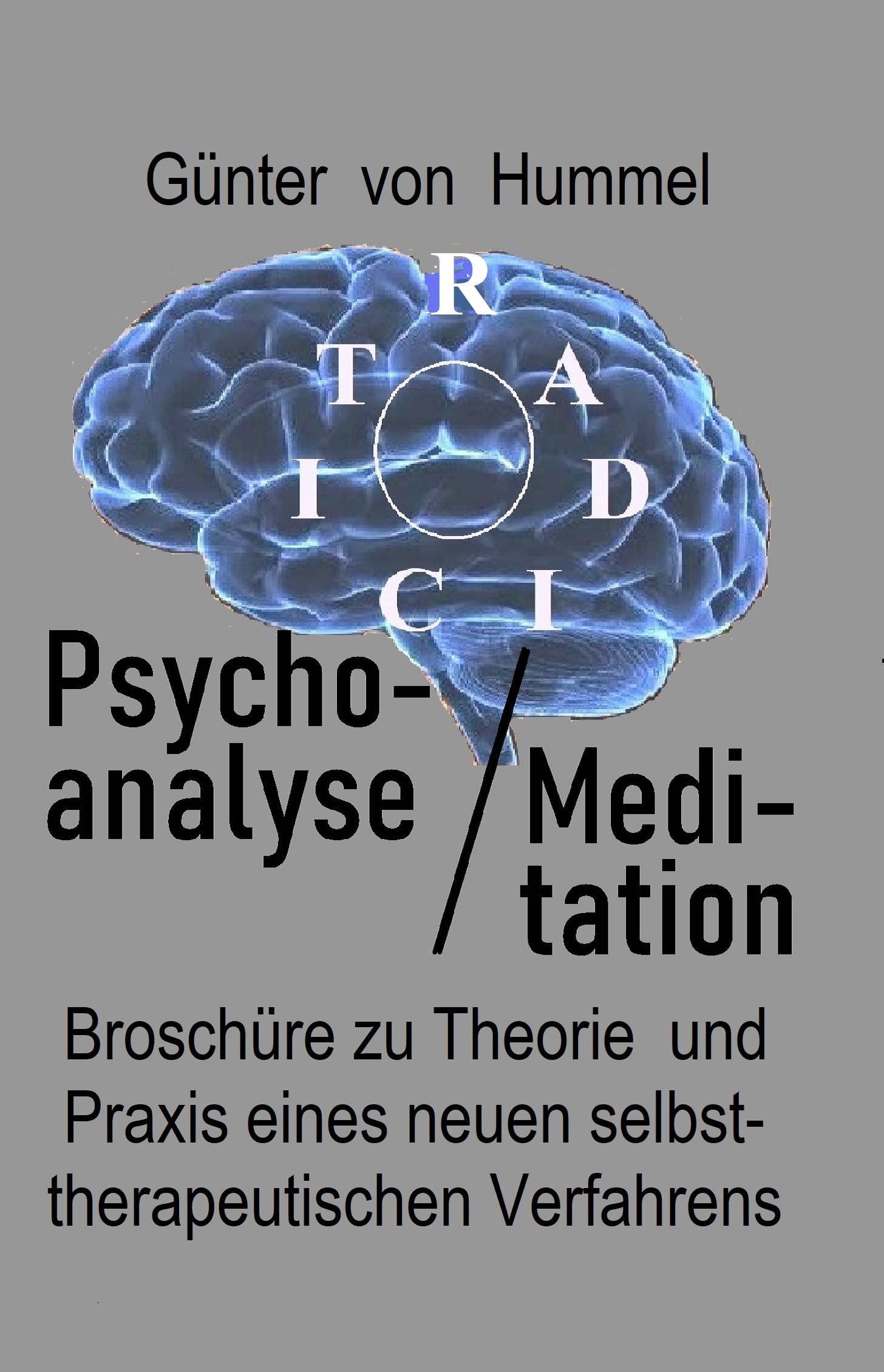Eines meiner Bücher hat den Titel: Vater seiner selbst, was mit der übertragenen Bedeutung des Wortes Vater zu tun hat. Zur Mutter seiner selbst kann man jedenfalls nicht werden. Das scheitert an der diesbezüglichen Geburts-Praxis, aber auch am Irrtum des Adonis, durch Verschmelzung mit der Muttergöttin stets aus ihr neu geboren zu werden. Und selbst wenn man sich vom Bemuttern losreißen kann, heißt dies ja nicht, dass es entscheidend zum selbstständig, kritisch und vernünftig werden führt. Auch Vater seiner Selbst zu werden ist nicht einfach, eben weil die Vatermetapher
zu komplex, zu ‚überdeterminiert‘ und mit großer Spannweite strukturiert ist. Zwar besteht immer eine eigene Möglichkeit dazu, aber diese muss ja trotzdem noch abgeglichen werden mit dem zentralen Kern des Unbewussten, hinsichtlich der ich vorläufig noch bei eben dieser Vatermetapher bleibe. Daher ist es vorerst vielleicht auch noch gut, dieses Symbol, diese Paternität in sich anzurufen, wenn es um die Transgenderproblematik geht, die die Geschlechterspannung innerhalb der erwähnten Buchstaben (LGBTIQ) am weitesten bzw. komplexesten treibt. Denn hier geht es um eine „Umwertung aller Werte“ wie Nietzsche es beschrieb, nämlich als Mann eine Frau oder umgekehrt zu sein.
Die Mann/ Frau-, die Transgender-Thematik, gab es schon immer. Nicht nur bei der queeren Figur des Adonis spielte sie eine Rolle, auch der griechische Seher Theiresias wurde von der Zeusgattin Hera in eine Frau verwandelt und als Hera ihn wieder zum Mann zurück transformierend nach zehn Jahren die bekannte alberne Frage stellte, wer denn nun beim Lieben mehr genieße, Mann oder Frau, er müsse es als der optimale Transgender doch nun wissen, sagte Theiresias: als Frau zehnmal mehr! Prompt schlug Hera ihn mit Blindheit, denn das wollte sie schon gar nicht hören. Nachdem ihr Gatte eine Affäre nach der anderen produzierte, wollte sie ihm beweisen, dass die Frauen gar nicht so viel davon hätten und das Ganze nur eine Lustwut der Männer wäre. Zeus milderte Heras Verdammung zur Blindheit etwas ab und verlieh Theiresias die Sehergabe. So löste man damals die Problematik, die sich hunderte von Jahren später in der Gestalt der Jeanne D’Arc, der Jungfrau von Orleans, wiederholte.
Jeanne D’Arc war – so würde man es heute zumindest auch sagen dürfen – ebenfalls eine queere Figur. Das liegt schon einmal an ihrer Neigung zur Männerkleidung und ihrem Streben nach männlichen Heldentaten, auch wenn man dies alles – ebenso nach heutiger Manier – als harmlos neurotisch einstufen könnte. Ich will auch ihrer Größe keinen Abbruch tun. Bekanntlich hörte sie schon als Kind ‚Stimmen‘, die ihr anfänglich zu verstärktem Glauben an Gott und an die Kirche rieten. Später erschien ihr jedoch ein Mann mit ‚schneeweißen Flügeln‘, der sich als Erzengel Michael entpuppte und sie zum Kampf gegen England aufrief. Er war es, der ihr dann auch versprach, wo sie sich Männerkleidung besorgen und wie sie zum König gelangen könnte. Strenger Katholizismus und Männerherrschaften bestimmten damals das Leben, und so nahm alles zuerst seinen typischen, zeitgetreuen Verlauf, den man damals zu Recht nicht als queer bezeichnete. Derartige Bezeichnungen kannte man noch nicht. Aber ungewöhnlich, seltsam und für die Eltern sicher besorgniserregend war Jeanne D’Arcs Auftreten durchaus.
Trotzdem können wir von heute und von der heutigen Wissenschaft, speziell auch von der Psychoanalyse her, eine etwas andere Einschätzung dieses ‚himmlischen Mädchens‘ und ihrer faszinierenden Persönlichkeit geben. Demnach lag also wohl tatsächlich etwas Neurotisch-Hysterisches vor und auch eine gewisse Transgendertendenz kann man dem Fall Jeanne D’Arc von heute aus gesehen wohl doch zuordnen. Der Hang zur Männerkleidung und auch zu männlichen Durchhaltegedanken spielte nämlich noch ganz am Schluss, als Jeanne D’Arc schon lange in Gefangenschaft war, eine weiterhin bestimmende Rolle. Dort hatte sie sich wieder Soldatenhose und -jacke angezogen, und es kam zum Streit, zu einem längeren Hin und Her mit dem Gefängnispersonal darüber, ob sie dies nur zum Schutz vor männlichen Zudringlichkeiten angezogen habe oder nicht. Mit Sicherheit hat Jeanne D’Arc niemals daran gedacht, ein Mann sein zu wollen im Sinne einer weitgehendst (psychisch und phallisch) männlichen Identität. Aber männliche Attribute zogen sie stark an. Und warum war es der Erzengel Michael, der immer mit männlichen Attributen wie Schwert und Lanze dargestellt wird und nicht eine andere fromme Gestalt? Trotzdem war Jeanne D‘Arc auch eine ‚Heilige‘.(1)
Bestrebungen zum Geschlechtswechsel sind erst mit den Möglichkeiten körperlicher (hormoneller und chirurgischer) Angleichung stärker geworden. Heute wirken die Geschichten, die wie die von Adonis, der gleichermaßen männlich wie auch feminin war, weil vom gleichen Fleisch wie Aphrodite erstellt, interessant, aber auch mystisch-magisch unplausibel. Auch die Erzählungen von Männern, die sich in Frauenkleidern präsentierten, die versteckt homosexuell waren oder feminine Spielarten bevorzugten, wirken antiquiert. Genauso verhält es sich mit den männlichen Frauen, die sich burschikos und jungenhaft geben, die ‚zu Hause die Hosen anhaben‘ wie man sagt, oder gar die perfekte Domina sind. Der indische Psychoanalytiker, G. Bose behauptete, dass grundsätzlich jeder, Mann und Frau, einen Transgender-Wunsch habe, und so entwickelte er im Gegenzug zu Freuds Definition des Ödipuskomplexes den Komplex der „gegensätzlichen Wünsche“ (opposit wishes) oder Affekte. Der von Freud postulierten Kastrationsangst des Knaben setzte er z. B. den unbewussten und libidinösen „Wunsch eine Frau zu sein“ gegenüber. Dieser unbewusste Wunsch musste dann vom Therapeuten dem Patienten bewusst gemacht und mit der äußerlichen Situation versöhnt werden. Allerdings geriet Bose oft in Konflikte, wenn seine Patienten sich zu stark gegen seine Kriterien wehrten.
‚Heilige‘ wie Jeanne D’Arc landen heute vorzugsweise in der Psychiatrie. So beschrieb der indische Psychoanalytiker S. Kakar, dass eine Person, die bei uns als persönlichkeitsgestört gilt, in Indien eine Heilige wäre und umgekehrt ein indischer Heiliger wie Ramakrishna bei uns als „psychotisch“ gelten würde.(2) Allerdings ist diese Gegenüberstellung zu pauschal und psychologisch nicht genug durchdacht. Man könnte Jeanne D’Arc auch eine hypomanische Abwehr unterstellen. Ein derartiges unbewusstes Sich-Wehren bedeutet, dass man sich in eine gehobene Stimmung und Aktivität manövriert, weil man beispielsweise eine Infragestellung des eigenen Selbstbildes abwehren möchte. Dann steht nicht nur das libidinöse Begehren im Vordergrund, sondern etwas Aggressives. Schließlich ist an dem militärischen Eifer Jeanne D’Arcs nicht zu zweifeln, und man kann sich fragen: wie kommt ein junges Mädchen vom Land dazu, sich ja auch wie glaubhaft berichtet vorstellen zu müssen, wie sie mit dem Schwert ihre Feinde durchbohrt. Selbst wenn man freudianisch berücksichtigt, dass in den Bildern, die man sich von Jeanne D’Arc mit Rüstung, Schwert und Lanze gemacht hat, ein hypomanisch-aggressives und libidinöses Element zu finden, mit dem sie eben die zu sehr weibliche Identität abwehrte.
Geht es heute nicht manchen Menschen mit Transgenderwunsch wieder so wie es Jeanne D’Arc ergangen ist? So z. B. wenn eine Transfrau, die sich mühevoll von allem Männlichen getrennt das Frausein hat erkämpfen müssen, dann dennoch nicht vollständig als Frau anerkannt wird? Man wird heute nicht mehr verbrannt, aber wird man nicht in schrecklichen Identitätskonflikten alleine gelassen? Inwieweit müssen wir uns alle damit beschäftigen? Freilich gibt es einen Zusammenhang zwischen Genderproblem und Neurose, schon Freud meinte, das erstere sei die Schattenform des letzteren. Aber es erklärt nicht alles. Und auch wenn Lacan vom transsexuellen Delir sprach, also vom Paranoisch-Psychotischen, ruft dies heute, fünfzig Jahre später, nur Unverständnis hervor.
Daran ändern auch die modernen Transgenderdiskussionen nicht viel, in denen die Auffassung vertreten wird, dass ein perfekter Wechsel des Geschlechts und damit Kenntnis beider Identitäten von einer Person erfahren werden kann und somit Kluft und Spannung überwunden sind. Man braucht dann von der sexuellen Beziehung nicht mehr zu reden, man ist sie ja, verwirklicht sie ja in sich selbst. Man ‚transsubstanziiert‘ sie einfach, wenn ich einmal dieses sonst in der Theologie gebrauchte Wort verwenden darf. Aber wie die Theologen wollen die Transgender nicht viel vom Sexuellen wissen. Sie lehnen den Begriff Transsexualität ab und ziehen es vor als Transgender-Personen bezeichnet zu werden. Sie wollen nämlich nicht das andere ‚Geschlecht‘ im eingeengten Sinne sein, sondern die andere Person, das andere Wesen, behaupten sie stets.
Freud äußerte sich dazu in seinem dreißig-bändigen Werk überhaupt nicht. Er wusste auch nicht, was bei den Frauen eigentlich los war. Mit seinem berühmt gewordenen Satz „Was will das Weib“? erhoffte er sich wenigstens von den angehenden Psychoanalytikerinnen, eine Antwort zu bekommen. Gefühle, erotische Selbstbestimmung, sagten sie, aber eine Antwort auf seine Frage bekam er nicht. Das liegt freilich auch daran, dass er nach dem Willen fragte und nicht nach dem Wollen. Was ist das Wollen der Frau? Vielleicht – wenn Theiresias sich schon bezüglich seines Frauseins so übertrieben geoutet hat – geben die Transgender selbst eine passendere Antwort.
Zumindest geht es bei den Transgendern um etwas Analoges, Ähnliches, wie ich es mit dem Begriff der Transsubstantiation und deren Elementen und der weiterführenden ‚logischen Selbststruktur‘ versuchen will. Was ein Transgender ist, ist ein bisschen kompliziert zu sagen, dennoch hat es die ungarisch jüdische Autorin Susan Faludi in einem Buch ganz originell zu beschreiben versucht.(3) „Die Autorin“, so ein Kommentar in der SZ vom 4. 11. 18, „bekommt eine E-Mail von ihrem Vater. Die beiden hatten seit 25 Jahren wenig Kontakt, während der Scheidung der Eltern in den Siebzigerjahren war es zu gewalttätigen Szenen gekommen, so dass die Tochter den Vater auf Abstand hielt. „Liebe Susan“, schreibt der Vater jetzt als wäre nie etwas gewesen, „ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Ich bin zu dem Schluss gelangt, dass ich lange genug den aggressiven Macho gespielt habe, der ich innerlich nie war.“ Anbei Fotos des Vaters in Rock und Rüschenbluse. Sie zeigen ihn, nein: sie nach einer geschlechtsangleichenden Operation in Thailand. Die Unterschrift lautet: ‚Love, your parent Stefánie‘.“
Kurze Zeit später reist Faludi nach Budapest. Ihr Vater stammt von dort und lebt wieder da, seit die Familie in den USA auseinandergebrochen ist. „Konnte eine neue Identität die vorangegangene nicht nur ablösen, sondern gleich vollständig auslöschen“, fragt sich Susan Faludi. Sie findet eine alte Dame vor, an der ihr zumindest eine entnervende Angewohnheit vertraut ist: Sie redet ohne Unterlass und wischt unerwünschte Einwände lapidar beiseite.“ Die Autorin stellt wohl zu Recht fest, dass der Wechsel des Geschlechts nichts an der eigentlichen Identität ihres Vaters geändert hat, der nun was ist, Mutter, Frau, ältere Tante oder ‚Androgyn‘?
Der Vater Faludis war immer noch zumindest ein wenig der alte Macho geblieben, und so fragt sich natürlich, was geschlechtliche Identität eigentlich ist. Faludi „bezieht sich auf den Psychoanalytiker Erik H. Erikson, der in den Sechzigerjahren über das ‚subjektive Gefühl einer bekräftigenden Gleichheit und Kontinuität‘ schrieb“. Ich glaube jedoch, dass die Ableitung der Identität von den Genen oder den sozialen Gründen nicht genügt. Bei ihrem Vater war sich die Autorin ziemlich sicher, dass sein Leben vorher auch schon immer aus verdeckten Wechselspielen bestanden hat. So weist sie auf die vielen Verkörperungen ihres Vaters hin: Jude im Budapest des Zweiten Weltkriegs, dann Abenteurer im Amazonasgebiet und All-American Dad und heute eben eine Frau, die ihr Judentum wiederentdeckt hat. Jedenfalls führt der Psychoanalytiker den Identitätswechsel auf das Unbewusste zurück, das Lacan als „linguistischen Kristall“ bezeichnet, als etwas, das in Phonemen Spricht (linguistisch) und in Pixeln (kristallin) Strahlt.(4)
Lacan sprach also vom „transsexuellen Delir“, von einer wahnhaften Identität, von der vielleicht kein Mensch ganz frei ist, die aber den Namen zu Recht verdient, wenn sie zu ausgeprägt, zu gefestigt und fixiert ist. Das konnte ich bei meiner Tätigkeit in der Psychiatrie oft beobachten, wo der reine Paranoiker immer eine logische Erklärung im Brustton massivster Überzeugung parat hatte. Notfalls war es der amerikanische Geheimdienst, der Schuld an den Lebensverwicklungen war, denn von dem weiß man ja, dass er zu allem fähig ist, aber keine Möglichkeit eines Gegenbeweises hat. Die Transgenderthematik ist freilich komplizierter als eine einfache Paranoia.
Im SZ-Magazin vom 7. 12. 18 wurde über zwei Transmenschen, einem Mann und einer Frau, berichtet, die beide zumindest äußerlich perfekt dem neu gewählten Geschlecht entsprachen. Beide hatten sich schon früh dem anderen Geschlecht ähnlich gefühlt. Bei beiden war wohl die Angleichung der Genitalien nach hormoneller und kosmetischer Vorbereitung nicht so perfekt, sie betonten jedoch – wie schon erwähnt – sehr explizit, dass es ihnen hauptsächlich um die psycho-soziale Veränderung gegangen sei, um ihre völlige ‚Transition‘ wie sie sagten, nicht um die Sexualität. Und selbst wenn die Sexualität miteingeschlossen ist, finden sich beide jetzt großartiger, interessanter, wichtiger, besser. Ist das ein Delir?
Sie haben große Mühen und Leiden auf sich genommen, keine Frage. Sie sind vielschichtiger geworden, differenzierter. Aber haben sie sich wirklich – wie es S. Faludi bei ihrem Vater auch gefragt hat – so weitgehend verändert, dass der frühere Junge (in dem gerade geschilderten Fall bis zum 20. Lebensjahr) oder die junge Frau (bis zum 37. Lebensjahr) kaum noch eine Rolle spielen? Kann man – erneut gefragt – den psychisch-biologischen Mix wirklich so trennen, wirklich so transitieren, ja transsubstantiieren? Oder verwirklichen sie jetzt einen Mix aus beiden, der jetzt nur schwerpunktmäßig auf dem neuen Geschlecht liegt? Doch dann hätten sie ein vergleichbares Problem wie die Intersexuellen, die Hermaphroditen z. B., die sich im Leben mit der zweifachen Biologie schwer tun und sich dann meist doch für eine Seite entscheiden. Oder hat vielleicht die Bild-Wirklichkeit über die Wort-Wirklichkeit triumphiert, denn man hat das Gefühl, dass sich die Menschen in all diesem Identitären vorwiegend spiegeln und diesen Spiegel jedoch nicht durchbrechen. Sie beharren unwahrscheinlich auf dem anderen Geschlecht, doch wie verworten sie das, wie setzen sie das in der Wort-Wirklichkeit um?
Die Transgender betonen gerne, dass die Ursache für ihr Leiden angeboren oder innerlich fixiert ist und durch das eben anders gepolte Gehirn bewirkt wird. Aber wie können die Gene zu einem männlichen Körper ein völlig weibliches Gehirn schaffen? Am Unbewussten kann es nicht liegen, denn Freud bewies, dass das Unbewusste die Unterscheidung Mann / Frau nicht kennt. Es könnte höchstens im Unbewussten liegen. Lacan schreibt, dass der sogenannte ‚kleine Unterschied‘ ein Wort-Wirkendes ist, ein Spiel der Signifikanten mit den kleinen Äußerlichkeiten. Wenn man aber das Geschlecht wechseln will, muss „man einen Preis auf diesen ‚kleinen Unterschied‘ zahlen, der durch Vermittlung des Organs auf trügerische Weise ins Reale übergeht, und zwar dadurch, dass es aufhört für ein solches gehalten zu werden, wobei es zugleich enthüllt, was es heißt, ein Organ zu sein, nämlich, dass es sich doch sehr erheblich auf das Wort-Wirkende gründet“. Und weiter:
„Der Transsexuelle will das Organ nicht mehr als Wortwirkendes und erliegt so einem ganz gewöhnlichen Irrtum“, indem er das Bild-Wirkende des Genießens und der Lust total von dem Wort-Wirkenden der Nominierung, Substanziierung, als Mann oder Frau trennt. „Er will durch den sexuellen Diskurs, der – wie ich behaupte – unmöglich ist, nicht mehr witzhaft durch den ‚kleinen Unterschied‘ definiert, erfasst, bestätigt und nominiert werden“.(5) Deswegen versucht er den Diskurs durch eine Verwandlung zu erzwingen, so Lacan. Und deswegen sagt er, dass es ihm generell um Identität geht und behauptet, dass Gene, Gehirn oder einfach eine innere Überzeugung ihn dazu gezwungen haben und nicht eine Verschiebung des Bild- und Wortwirkenden.
Nach Lacan ist der Transgender sozusagen humorlos und kann also das Wortspiel, den Wortwitz mit dem ‚kleinen Unterschied‘ nicht mitmachen. In vielen asiatischen Ländern gibt es oft mehr als vier oder fünf Geschlechts-Identitäten, aber sie haben alle etwas leicht Obsessionelles, Affektioniertes an sich. Bei dem von mir oben zitierten indischen Psychoanalytiker G. Bose verhielt es sich – was die Transgenderproblematik angeht – jedoch oft umgekehrt. Während bei uns im Westen die Tendenz besteht, dass sich heute auffallend mehr Menschen im falschen Körper aufgewachsen fühlen, zwang Bose seine Klienten, die meist nicht transsexuell waren, ganz intensiv mit dieser Identität des anderen Geschlechts zu verschmelzen, was oft negative therapeutische Reaktionen hervorrief. Vielen konnte er aber auch helfen, was letztendlich zu der gleichen Geltendmachung führt, wie ich sie oben erwähnt habe. Die Soziologin G. Lindemann, die eine ausführliche Dokumentation zur Transgenderproblematik schon in den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts vorgelegt hat, schreibt sehr klar, dass die Transgender genauso wie die anderen Menschen das sein wollen, was in deren Augen aller eben nicht nur geschlechtliches Sein, sondern Sein in jeglicher Hinsicht ist:
„Wir alle sind Frauen oder Männer, indem wir den Eindruck erwecken, wir seien es. Wenn ich das Haus verlasse und einen Nachbarn grüße, tue ich das, ohne darüber unbedingt nachdenken zu müssen, auf eine Weise, die für alle glaubhaft macht, eine Frau verlässt das Haus. . . . Bei Transsexuellen wird folglich nur die Reflexivität sichtbar, die auch für das Frau- bzw. Mann-Sein von Nichttranssexuellen konstitutiv ist“.(6) Oder anders ausgedrückt: latent sind wir alle Transgender, wir sind aber mit dem uns angeborenen und sozial weiter formenden Geschlecht zurande gekommen und brauchen deswegen keine Veränderung und Diskussion darüber. Noch idealer hat es T. Schachl formuliert, wenn sie die Bewegung beschreibt, die „in verschiedenen Stadien der Sichtbarkeit: von der Diagnose transsexuell über die präoperative transsoziale Phase des Outings und des Ankommens im gewissermaßen unsichtbaren Ganz Normalen“ verläuft.(7)
Obwohl Schachl „Metapher Forscherin“ ist, Fachfrau für die Phoneme und Sprache, erkennt sie, dass die Transgenderproblematik in „der Betonung von ‚Sehen‘, ‚Sichtbarkeit‘ und ‚Bildern‘ [also der Inflation von Pixeln], liegt. Sie spricht vom ‚Banner der Sichtbarkeit‘, für das ein ungeheuer hoher Preis gezahlt wird“, um dieses perfekte Bild des um die zwei Ecken des Geschlechtlichen und des möglichst Normalen sich Drehenden darstellen zu können. Nichts freut die traditionelle Allgemeinheit mehr, als dass dadurch Grenzziehungen geboten werden, mit der man sich vor sich selbst als eben traditioneller Allgemeinmensch schützen kann. Denn in Wirklichkeit enden Transgender wie alle anderen auch in einer um die zwei Ecken herum stumm bleibenden ‚Unsichtbarkeit‘, schreibt Schachl. Der Transgender fühlt sich in seinem Erstgeschlecht nicht wahrgenommen, nicht richtig bestätigt, und so versucht er nun um dieser Bestätigung und des Wahrgenommenseins willen, das Geschlecht zu wechseln, weil er gesehen hat und glaubt, dass es in dieser Form funktionieren wird, n o r m a l funktionieren wird. Man will endlich normal Frau oder Mann sein, weil dies im Ausgangsgeschlecht nicht der Fall war. Die Betonung liegt auf der Normierung.
Nun genügen alle diese Stellungnahmen immer noch nicht. Es hat mit dem Problem des Wort- und Bild-Wirkenden zu tun, was Lacan übrigens mit dem verbalen und imaginären Signifikanten bezeichnet, mit Phonem und Pixel, mit Sichtigkeit und Symbolik. Diese Zweiheit von Schwerpunkten, von verschiedenen Gewichtigkeiten, verteilen sich unterschiedlich auf das, was Mann, Frau, Mutter und Vater effektiv ausmacht. So assoziieren die meisten Menschen weltweit zu Mutter genau all dies wärmende, hegende, nährende, kosende und liebende Verhalten, wie es auch der Schriftsteller Oskar M. Graf in seinem Buch ‚Das Leben meiner Mutter‘ beschrieben hat. Er hat hunderte Briefe von überall her bekommen, weil die Menschen ihm zustimmten und sagte: „Genau so war auch meine Mutter“. Mutter, das lässt sich sehr schnell auf Wesentliches und Typischen eingrenzen, auch wenn es einmal eine nicht so gute Mutter gibt. Auch zu Mann gibt es eingegrenzte und allgemein bekannte Assoziationen.(8)
Ganz anders beim Thema Frau, bezüglich der im Moment eine sonderbare Diskussion darüber ausgebrochen ist, wen man überhaupt als Frau bezeichnen darf! Begonnen hat diese Auseinandersetzung mit Bemerkungen der Harry Potter Autorin Joanne K. Rowling, die sich über einen Artikel lustig machte, in dem die Rede von „Menschen, die menstruieren“, war. „Menschen, die menstruieren. Ich bin mir sicher, dass es dafür mal ein Wort gab. Kann mir jemand aushelfen? Wumben? Wimpund Woomud?“, twitterte die Autorin. Nach dem Tweet wütete schnell ein Shitstorm gegen Rowling. In tausenden Kommentaren wurde ihr vorgeworfen, dass sie unsensibel und transphob agiere.
„Die Britin reagierte daraufhin mit einer Reihe an Tweets. ‚Wenn es Geschlechter nicht gibt, kann es auch nicht gleichgeschlechtliche Anziehung geben‘, twitterte sie etwa. ‚Ich kenne und liebe transsexuelle Menschen – sobald wir aber das Konzept von Geschlecht auslöschen, entfernen wir die Möglichkeit, sinnvoll über dieses Thema zu sprechen. Es ist nicht Hassrede, wenn man die Wahrheit spricht‘, führte die Autorin aus“.(9) Es folgten noch weiter Hin- und Her-Kommentare, in denen Rowling darauf bestand, dass das Geschlecht biologisch bestimmt sei, und sie in diesem Sinne als Frau glücklich lebe.
Es waren vor allem die Transfrauen, die also einmal ein Mann waren, und das Wort Frau nicht in Verbindung mit Menstruation bringen wollten. Denn auch das ist wieder einmal ein „kleiner Unterschied“, der diskriminierend verwendet wird. Doch wer oder was ist dann Frau? Wenn das Geschlechtliche nicht zählt, was dann? Da kommt wieder Lacan zu Hilfe, der allerdings aus ganz anderen Gründen häufig behauptet hatte, dass es d i e Frau überhaupt nicht gibt. Auch er ist mit Shitstorm überzogen worden, und zwar nicht nur, als der Corriere della Sera schrieb: „Per il dottore Lacan le donne non esistono“. Natürlich gibt es Frauen, aber eben nicht d i e, die mit dem universalierenden Artikel. Es gibt eben nur immer wieder eine Frau, eine jede für einen jeden, sinnierte er. Und so muss man zum Vater-Namen und zum Herrensignifikanten zurückkommen, um weiter an der ‚logischen Selbststruktur‘ zu bauen.
[1] Ich schreibe ‚Heilige‘ in Anführungszeichen, weil Heiligkeit immer schon schwer einzustufen war, aber so kann man es stehen lassen.
[2] Kakar, S., Der Heilige und die Verrückte, Religiöse Ekstase und psychische Grenzerfahrung, Beck (1993)
[3]Faludi, S., Die Perlenohrringe meines Vaters, dtv (2018)
[4] Weitere Begriffserklärungen dazu, in denen ich das Unbewusste ein Es Spricht und ein Es Strahlt nenne, später.
[5] Lacan, J., Seminar XIX vom 8. 12. 71
[6] Lindemann, G., Das paradoxe Geschlecht, Fischer (1993)
[7] Schachl, T., Transsexuell, eine sichtbare Bewegung ins Unsichtbare, Profil (1997)
[8] Ich assoziiere nur in der Fußnote: physische Stärke, Begeisterung für Sport, Technik, Politik, berufliche Identität etc.
[9] Der Standart, Webmix vom 8. 6. 2020